75. Filmfestspiele von Venedig 2018
Die Geburt der Gegenwart aus dem Geist des Highschool-Massakers |
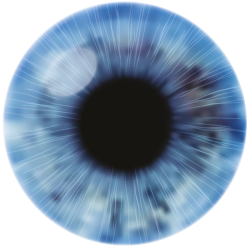 |
|
Starpower und der Angriff auf die übrige Zeit. Natalie Portman in Brady Corbets außergewöhnlichem Film über Vox Lux – Notizen aus Venedig, Folge 9
»Shooting stars never stop
Even when they reach the top«
Frankie Goes to Hollywood: Welcome to the Pleasuredome
+ + +
Gute Filme sind ein Raum, in dem man sich bewegt, sich aufhalten kann, zu dem man sich verhalten kann und muss. Filme sollten ihrem Publikum nichts vorkauen, sondern Schneisen öffnen, und Orte der Sicherheit wie der Herausforderung. Ein solcher Film ist neben anderen – Sunset (siehe Folge 10) und Suspiria (siehe Folge 6)– auch Vox Lux vom Amerikaner Brady Corbet, der vor drei Jahren mit Childhood of a Leader den besten Film des Festivaljahrgangs präsentierte, der seinerzeit zu Recht zwei Preise gewann.
Es geht um Celeste, einen Megastar der Popmusik. Natalie Portman spielt die erwachsene, Raffey Cassidy (The Killing of a Sacred Deer) die junge Celeste, und dann auch deren Tochter.
Portman spielt in dieser Rolle auch ein bisschen ihre eigene Geschichte: Mit dreizehn wurde sie durch den brutalen, auch ein bisschen exploitativen Film Leon – der Profi zum Weltstar. Und immer unter Beobachtung, experimentierend, verhärtend, beschimpft, gefeiert. Ein Weltstar unter Druck. Und man kann diesen Auftritt nicht sehen, ohne auch Black Swan mitzudenken.
Jude Law ist als Celestes Manager zu sehen. In vier Kapiteln erzählt Corbet Werdegang, Durchbruch und Celestes Leben siebzehn
Jahre später, als der Weltruhm längst Routine und Belastung ist.
+ + +
Corbet zeigt, wie etwas wird, was es ist. Weil sie das »certain something« hat. Zum Schlüsselerlebnis der Celeste-Figur wird ein Highschool-Massaker, das sie knapp überlebt, mit einer schweren Wirbelsäulenverletzung, doch durch dass sie zugleich über Nacht berühmt wird. Danach suchen sie ihre inneren Dämonen über ihre gesamte Karriere heim. Die ist schüchtern, aber entschlossen, zu rein für diese Welt und von ihrem Namen her ein himmlisches Geschöpf.
Corbet beschreibt die Geburt der Popkultur aus dem Highschool-Massaker. Genaugenommen sogar die Entstehung des ganzen Zeitalters. Die Folgen von Radikal-Individualisierung und Reaganomics. Dies ist, wie seinerzeit »Childhood of a Leader« eine geschichtsphilosophisches Portrait der geistigen Situation der Gegenwart: Celeste prototypischer Charakter wird wie folgt beschrieben: »Her universal feeling of betrayal and exclusion mirrored that of the society.«
Der Film macht spürbar, das es mit uns alles so gar nicht weitergehen kann. Das Dasein als lebende Hölle ist die apokalyptische Signatur der Zeit.
Hier hilft er sich mit der Schilderung einer surrealen Erfahrung: »...during those moments between beeing dead and alive, she had met the devil.«
»One for the money. Two for the show. Three to make ready. And four to go.«
+ + +
Nur der Ordnung halber möchten wir darauf aufmerksam machen, wie sich auch hier ein Trend fortsetzt: Noch eine Mutter-Figur, noch eine Mutter-Tochter-Geschichte. Und sowieso: Drei weibliche Hauptfiguren, denn auch die von Stacey Martin gespielte Schwester Eleanor ist eine sehr wichtige Figur. »I'll tell the world, that i raised her kid, and I wrote her songs.«
Celeste gibt Interviews, die aus dem Leim gehen, in denen sie aber auch viele kluge Sachen sagt, und den Interviewern
sinnloserweise darlegt, die Gegenwart werde überschätzt, die Vergangenheit wiederum, versuche man aus dem kollektiven Gedächtnis zu tilgen: »Alles heute ist gegen Vergangenheit gerichtet, man versucht Vergangenheit zu töten, zu vergessen.« Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit.
Gekontert wird solche Klarsicht durch Selbstüberschätzung: »I am a new faith«. »I don’t want people to think, I just want them to feel good.«
+ + +
Stilistisch ist Vox Lux sehr virtuos. Die Einflüsse von Michael Hanekes kühler Rationalität und Bertrand Bonellos Ästhetizismus, von beider faszinierter Verachtung der Popkultur sind unübersehbar. Auf 35mm, zwischendrin aber auch 70mm, Super-8 und Video-Material gedreht. Die Kamera bleibt ruhig, Corbet liebt Auto-Fahrten, die aus der Subjektiven gefilmt sind. Dazu die Orchester Musik von Scott Walker – dieser Film hat immer wieder Momente der Perfektion.
Aufgebaut wie eine Symphonie hat diese Symphonie der Stars einen ironischen Grundton. Es wird bemerkt, wie sie auf den Rat kluger Leute bei ihrem ersten Lied im Text das »I« in ein »we« änderte, und dann das Resultat: »Simply put: It was a hit.«
Dieser Film ist zum Teil pure Satire, dann wieder ein Gesellschaftskommentar. Auch ein Trip. Wie Corbets erster Film ist dies ein labyrinthisches Konstrukt aus Verweisen, das fiktionale Figuren mit historischen Fakten und
Schlüsselereignissen aufs Eleganteste kombiniert, sie zu deren Augenzeugen macht. So kreiert der Film die albtraumhafte Version des gegenwärtigen Star-Zirkus, der Venedig fast zu präzise spiegelt, ob Lady Gaga in der Version von A Star Is Born, ob Portmans eigene regelmäßige Präsenz am Lido und ihre Verkörperungen von Pop-Idolen (Black Swan, Jackie), ob die Stars und Sternchen, die hier auf den großen Sprung hoffen und allzuoft in der Lagune versinken.
Corbet ist ein Filmemacher voller Ambition und von enormem Selbstvertrauen.
Corbet denkt in Bildern, und er denkt genau.
+ + +
Seine Frage ist: Was heißt es, ein Star zu sein? Was sind Stars? Die Wege zum Ruhm sind hier das Gegenteil von Donnersmarcks idealisierter, religiös grundierter Idee vom Künstler als reinem Helden (siehe Folge 8); für Corbet ist Kunst korrupt und ein von allen Lastern infizierter Spiegel der Dekadenz unserer Zeit. Die allerdings zeigt er in schillernder Pracht.
+ + +
Ein Star, wenn auch kein Weltstar, ist auch Paula Beer. Im deutschen Wettbewerbsbeitrag Werk ohne Autor spielt sie neben Saskia Rosendahl die weibliche Hauptrolle.
Paula Beer ist in diesem Film leider nicht gut. Einfach nicht gut. Eine meiner Ansicht nach sowieso überschätzte Schauspielerin, deren Schwächen hier, mit einem Regisseur, der sie nicht wettmachen kann, bloßgelegt werden.
Wer Paula Beer dann in Venedig persönlich erlebte, der erlebte eine Schauspielerin, die in Wirklichkeit noch viel magerer aussieht, als auf der Leinwand, erschreckend. Bei einem Mann würde man das im Übrigen genauso schreiben.
Wer mit ihr zu tun hat,
berichtet von kompletter Fehleinschätzung ihrer Bedeutung, ihrer Bekanntheit in Italien durch die persönlichen Agenten, was dann von ihr, wie soll sie es auch besser wissen, entsprechend gespiegelt wird: Mit Arroganz, die in Unsicherheit wurzelt, mit jenen dauernden kleinen Extravaganzen und Launen, die sich ganz große Stars tatsächlich herausnehmen und die kleine Sternchen darum auch an den Tag legen zu müssen glauben.
+ + +
Ein Teufelspakt. Corbets Frage, was es heißt, ein Star zu sein, was Stars überhaupt sind, kann man auch auf alle anderen Venedig-Filme und das Festival insgesamt übertragen. Vox Lux zeigt, was Star-sein bedeutet: Der Starbetrieb ist ein vampirischer Betrieb, ganz oder gar nicht. Stars wie Celeste sind Täter und Opfer zugleich. Und er dringt hinter die Klischees vom kleinen unschuldigen Mädchen, das angeblich in den Star-Körper eingeschlossen ist – nichts wäre weniger wahr. Celeste, und nicht nur sie – ist ein little lost girl, aber auch ein hoffnungsloser Fall, in ihr – und nicht nur in ihr – steckt nicht ein anderes besseres Ich, sondern womöglich – das wäre die schlimmste Einsicht – nichts.
Kurz vor Schluss, kurz vor dem großen Konzert, das Celeste in roboterhafter Perfektion in Vox Lux gibt, sieht man, wie sich das private Wrack in einen Star verwandelt, man sieht alles: Die Hysterie, den Stress, die Drogen und das Zusammenreißen.
Dieses Zusammenreißen in der Öffentlichkeit ist die entscheidende Erfahrung, die Vox Lux vermittelt; der Kontrast zwischen dem Auftritt, den smarten (oder schein-smarten) Kommentaren für die Öffentlichkeit und demgegenüber dem Abgrund des Privaten und der hauchdünne Firnis, der das eine vom anderen trennt. Er wird hier sichtbar.
(to be continued)
- 75. Filmfestspiele Venedig 2018 – Rüdiger Suchslands Notizen – unser Special im Überblick