Die Signatur unseres Zeitalters |
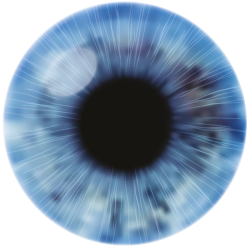 |
|
Rückkehr zu Schwarzweiß & Boom der Vergangenheit: Der Europäische Filmpreis und der Stand des Kinos
Es kam, wie es kommen musste, wie es Fans und Gegner dieses Films spätestens nach Bekanntgabe der Vornominierungen erwarten konnten: »Cold War«, der Film des polnischen Regisseurs Pawel Pawlikowski, hat beim Europäischen Filmpreis ganz groß abgesahnt.
Auf ihrer 31. Preisverleihung im andalusischen Sevilla hat die Europäische Filmakademie Cold War mit gleich fünf Preisen bedacht.
Eine verdiente Auszeichnung? Darüber kann man streiten. Nicht nur, weil dieser Film – eine zunehmend depressiver werdende Amour fou, die sich im Kalten Krieg über zwei Jahrzehnte und vier Länder erstreckt und mit dem Selbstmord des Paares
endet – sein Publikum spaltet.
Sondern vor allem, weil er politisch einseitig und vereinfachend ist. Das Bild der Vergangenheit wird hier glattpoliert: Wir sehen ein Polen, in dem es keine Kollaborateure mehr und keine Antisemiten gibt, keine humanen Sympathisanten des Kommunismus, sondern nur Verräter, Melancholiker und hässliche Kommunisten. Während die schönen Menschen alle katholisch sind und unter den bösen Roten leiden. So ist Cold War ein Fall von Gegenaufklärung und am ehesten ein Spiegelbild der Situation im aktuellen Polen, wo alles Liberale, alles Zukunftsweisende in Bedrängnis und auf dem Rückzug ist.
Cold War ist ein Film, der aber nicht in unserer Gegenwart spielt und mit ihr eigentlich auch gar nichts zu tun hat.
Mit seinem überaus altmodischen Blick auf Frauen und auf das, was man heute »Geschlechterverhältnisse« nennt, ist dies aber wohl das, was den rund 3000 Mitgliedern der Filmakademie tatsächlich gefällt.
Wer ist das überhaupt, die Europäische Filmakademie?
Salopp gesagt: ein Haufen bleicher alter Männer, garniert von wenigen Frauen.
Die Europäische Filmakademie weiß das selbst, darum hat sie sich in den letzten Jahren sehr bemüht, neue Mitglieder, vor allem Jüngere und Frauen, zu gewinnen. Einladungen wurden auf dem Kontinent verschickt, verbunden mit der Bitte, sie doch weiterzuleiten, falls man noch andere Interessierte kennen würde.
+ + +
Man sollte sich auch keine Illusionen machen im Hinblick auf das Demokratische des Wahlverfahrens. Hier gelten die gleichen Bedenken, wie bei den Massenabstimmungen der deutschen Filmakademie oder der Oscar-Academy: Schon die dort nominierten Filme sind repräsentativ für ein Milieu, für Vorlieben, Abneigungen, Filterblasen und Denksperren einer bestimmten Szene, die noch nicht einmal »die Filmszene« der jeweiligen Region umfasst.
Bekanntlich debattieren selbst die
Politikwissenschaften, wie demokratisch Mehrheitsabstimmungen überhaupt sind, bei denen der Sieger alles, die übrigen Kandidaten gar nichts bekommen – so gewinnt man wie bei demokratischen Parlamentswahlen mit maximal einem Drittel aller Stimmen. Wenn das Demokratie sein soll...
Andererseits: Kunst hat mit Demokratie nichts zu tun. Man kann über sie nicht abstimmen, beziehungsweise: Ein Abstimmungsergebnis sagt nichts aus über Kunst, sondern bestenfalls über
den Geschmack der Beteiligten.
Wichtiger ist die Frage, wo sich in diesen Preisen die Vielfalt des europäischen Kinos spiegelt? Wo sind die vielen anderen sehr guten oder herausragenden europäischen Filme des zurückliegenden Filmjahres am letzten Samstag geblieben? Was ist nicht alles schon bei den Nominierungen unter den Tisch gefallen!
Wo war der Däne Lars von Trier? Wo waren die Franzosen mit ihren so unterschiedlichen Meisterwerken Ava von Léa Mylius oder Climax von Gaspard Noé? Wo war der italienische Regisseur Luca Guadagnino, der mit Call Me by Your Name und Suspiria 2018 mit gleich zwei Filmen Premiere hatte?
Von den Deutschen, von Philip Gröning und Christian Petzold, wollen wir hier gar nicht reden. Immerhin 3 Tage in Quiberon war nominiert, und Der Hauptmann bekam sogar den Preis für den besten Ton.
+ + +
In anderer Hinsicht repräsentiert diese Preisvergabe immerhin den Stand des europäischen Kinos am Ende des Jahres 2018 und darüber hinaus perfekt die Lage des Kinos.
Filme aus Osteuropa waren in diesem Jahr allgemein stark: Aus Russland etwa Arrhythmia und Leto vom Russen Kirill Serebrennikow, der immerhin den Preis für die Bildgestaltung gewann und von der polnischen Regisseurin Agnieszka Holland in bewegenden Worten gewürdigt wurde. Serebrennikow
selbst ist inzwischen vom Putin-Regime unter Hausarrest gestellt worden.
Auch aus Ungarn, aus Rumänien, und eben aus Polen kamen überraschend viele gute Filme – jenseits von Cold War.
Und es gibt die Rückkehr von Schwarzweiß. Außer in Cold War auch in 3 Tage in Quiberon, in Der Hauptmann, in Leto.
+ + +
Ohne Frage ist Cold War gekonnt inszeniert. Das erklärt noch am besten die erstaunliche Tatsache, auf wie viel Gegenliebe Pawlikowskis doch auch recht eitles Konzeptkunst stößt.
Aber auch dieses Interesse und die fünf Preise vom Wochenende spiegeln nur die allgemeine Tendenz, die Signatur unseres Zeitalters, deren Zeuge wir gerade in Europa werden.
Eines Europa, das seltsam
erstarrt scheint, das wirtschaftlich perfekt zusammenarbeitet, sich aber vor den politischen und kulturellen Forderungen der Zukunft in die Vergangenheit zurückflüchtet.