71. Locarno Filmfestival 2018
Die Welt im Spiegel des Films |
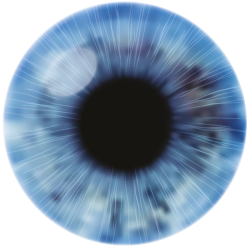 |
|
Mit einem außergewöhnlich starken Wettbewerb, zahlreichen cineastischen Leckerbissen und vielen schillernden Frauenfiguren, überwiegend von Männern in Szene gesetzt, verabschiedete sich der künstlerische Leiter Carlo Chatrian aus Locarno und setzte mit dem Programm Zeichen als Nachfolger von Dieter Kosslick in Berlin
Von Holger Twele
Neue Erzählformen?
In den vergangenen Jahren hat Locarno schon mehrfach Filme in den Wettbewerb genommen, die das Zeitraster einer »normalen« Kinovorstellung um ein Mehrfaches überschritten und – ja – es waren Meisterwerke darunter, bei denen das Zeitgefühl außer Kraft geriet. Der diesjährige argentinische Film La Flor von Mariano Llinás
allerdings ist 14 Stunden lang und kann leider nicht für sich in Anspruch nehmen, keine einzige überflüssige Szene zu enthalten. Faszinierend und bewundernswert, egomanisch und geschwätzig zugleich, mit großem Faible für das gesprochene und in Echtzeit geschriebene Wort und dennoch mit viel Humor gelingt es dem Regisseur, die halbe Filmgeschichte Revue passieren zu lassen, ausführlich über das Filmemachen und filmsprachliche Mittel zu reflektieren und obendrein die
klassische Filmdramaturgie infrage zu stellen und neue filmische Erzählformen auszuprobieren. Dazu gehört, dass der Film gleich zu Beginn seinen Aufbau genau erklärt. Es sind vier nicht zu Ende erzählte Geschichten unterschiedlicher Genres, vollkommen gegen den Strich gebürstet, mit einem zirkulären Mittelteil, dem sich zwei weitere Episoden anschließen, die in die Vergangenheit führen. Vier Schauspielerinnen in verschiedenen Rollen in den einzelnen Episoden bilden quasi
einen roten Faden, selbst wenn der Regisseur mitunter lieber Bäume als Menschen ins Bild rückt.
Der Film wurde sowohl in täglichen kurzen „Häppchen“ präsentiert, bei denen die deutlichen Längen vielleicht nicht ganz so ins Gewicht fallen, als auch in drei großen Teilen mit einkalkuliertem Besucherschwund und dem Wechsel in ein kleineres Kino. Wer bis zum Ende durchhielt, durfte sich als eingefleischter Cineast outen und sich ähnlich wie ein Bergsteiger fühlen, der im
Schweiße des Angesichts zu Fuß einen Gipfel erklimmt und mitleidig auf die herabblickt, die lieber die Seilbahn oder das Auto genommen haben. Ob dieser unbestritten innovative Film in den nur 15 Beiträge umfassenden Wettbewerb gehörte, sei dahingestellt. Die Entscheidung hatte immerhin den Vorteil, dass die vorhandenen Programmplätze wenigstens nicht mit überflüssigen Filmen gefüllt werden mussten, wie das beispielsweise bei der diesjährigen Berlinale der Fall war.
Asiatische Impressionen
Asiatische Wettbewerbsbeiträge haben eine lange Tradition in Locarno und gehen bei der Preisvergabe selten leer aus. So auch in diesem Jahr, in dem A Land Imagined von Yeo Siew Hua, eine Produktion aus Singapur in Kooperation mit Frankreich und den Niederlanden, den Goldenen Leoparden erhielt. Vor der gesellschaftpolitischen Folie einer dem Meer abgetrotzten riesigen Landgewinnungsbaustelle in
Singapur und den höchst problematischen Arbeitsbedingungen vieler Fremdarbeiter aus anderen asiatischen Ländern erzählt der Krimi in be(d)rückenden Bildern zwischen sozialer und virtueller Realität oder reiner Imagination die Geschichte eines Polizisten, der das spurlose Verschwinden zweier chinesischer Bauarbeiter aufdecken soll, die möglicherweise einem Verbrechen zum Opfer gefallen sind. – Nicht minder sehenswert waren die anderen beiden asiatischen Filme des
Wettbewerbs: A Family Tour von Ying Liang, eine Koproduktion zwischen Taiwan, Hongkong, Singapur und Malaysia, handelt von der als Familienausflug nach Taiwan deklarierten, in Wirklichkeit mühsam arrangierten Wiederbegegnung einer in Hongkong lebenden jungen chinesischen Regisseurin mit ihrer schwerkranken Mutter aus China. Was auf den ersten Blick eine persönliche Beziehungsgeschichte zwischen Mutter und Tochter scheint, entpuppt sich bald als
private und gesellschaftliche Tragödie ungeahnten Ausmaßes, bei der ein Happy End wegen der politischen Verstrickungen zwischen der Volksrepublik, dem »abtrünnigen« Taiwan und Hongkong mit seinem Sonderstatus ausgeschlossen ist. Denn die systemkritischen Filme der Tochter sind in China alle verboten, die Mutter, die bereits ihren Ehemann an das Regime verloren hatte, musste sich offiziell von der Tochter lossagen, und die einstige Wohnung der Familie soll obendrein einem
staatlichen Prestigeprojekt weichen. – Um familiäre Wiederbegegnung, Entfremdung, Aussöhnung und Verständigung geht es auch im südkoreanischen Film Gangbyun Hotel von Hong Sangsoo, der sich allerdings voll und ganz auf eine private Geschichte konzentriert. Die Begegnung von fünf Menschen im titelgebenden Hotel, einem alten Dichter mit seinen längst erwachsenen Söhnen und zwei jungen Frauen, von denen die eine von ihrem Mann betrogen wurde, ist
in strengen Schwarzweißbildern mit weitgehend statischer Kamera erzählt, wobei die schneebedeckte Winterlandschaft für zusätzliche Symbolkraft und Konzentration sorgt.
Kindheit und Jugend
Die Auseinandersetzung mit den Eltern beziehungsweise mit der eigenen Kindheit findet sich in zahlreichen Wettbewerbsfilmen, wobei einige von ihnen sogar aus der Perspektive von Kindern und Jugendlichen gedreht sind, also problemlos auch für die Berlinale-Sektion Generation 14plus geeignet wären. Fast alle stammen von Männern, bis auf Tarde para morir joven (Zu spät um jung zu sterben) von Dominga Sotomayor, eine
internationale Koproduktion mit Chile – der einzige Spielfilm im Wettbewerb von einer Regisseurin, die dafür den Preis für die beste Regie erhielt. Ihr Coming of Age-Film, der die Beziehungen zwischen den Generationen in einer Ausnahmesituation reflektiert, blickt zurück ins Jahr 1990 in die Zeit des Umbruchs unmittelbar nach Ende der Pinochet-Militärdiktatur. Einige Familien hatten sich damals in einer kleinen Gemeinschaft auf das Land am Fuße der Anden
zurückgezogen, um ihre Freiheit zu genießen und ein von der Zivilisation weitgehend unabhängiges Leben zu führen. Was für die jüngeren Kinder wie etwa die zehnjährige Clara noch Abenteuer pur, ist für die 16-jährige Sofía nur schwer ertragbar. Sie stirbt beinahe vor Langeweile, sehnt sich nach ihrer Mutter, die ihre Familie verlassen hat, und rebelliert gegen den allzu wortkargen Vater. Darüber hinaus drohen in der staubtrockenen Gegend, in der jeder Funke zur Katastrophe
führen könnte, neue Gefahren, was Sofía natürlich nicht davon abhält, ständig zu rauchen.
Der britische Fotograf Richard Billingham wurde durch seine Milieustudien und die Fotos seiner eigenen Familie berühmt, in der er mit zwei Brüdern in Birmingham am Rande der Gesellschaft aufwuchs. Ähnlich wie seinerzeit sein Landsmann Terence Davies erinnert er sich in seinem ersten Spielfilm Ray &
Liz in tableauhaft inszenierten Episoden an Schlüsselszenen aus dieser von absurden Ritualen und zunehmender Verwahrlosung geprägten Kindheit. Der sadistische ältere Bruder befördert den alkoholkranken Onkel beinahe ins Jenseits, während der jüngere Bruder am Ende in eine Pflegefamilie kommt, die fettleibige Mutter ein strenges Regime führt und der in einer aktuellen Rahmenhandlung immer noch vor sich hinvegetierende Vater jeden Impuls zur Eigeninitiative
unterdrückt. Für Billingham mag die Kunst die Rettung aus dieser übermächtigen ohnmächtigen Familienkonstellation gewesen sein. Und auch wenn der Film so gut wie keine Wärme oder Geborgenheit vermittelt, hinterlässt die dichte und präzise Inszenierung doch einen nachhaltigen Eindruck.
Autobiografisch geprägt ist auch der zweite Spielfilm Genèse des Kanadiers Philippe Lesage, der um erste Liebe, Verrat und Enttäuschung kreist und eine
unkonventionelle Erzählform findet, um dem altbekannten Thema neue Perspektiven abzuringen. Es scheint fast so, als wären die erste Liebe und der Wunsch, zu sich und den eigenen Gefühlen stehen zu können, trotz Aufklärung in einer sich liberal gebenden Gesellschaft nicht etwa einfacher, sondern weitaus komplizierter und störanfälliger geworden. Guillaume und seine Schwester Charlotte machen diese leidvolle Erfahrung im ersten Teil des Films. Der Junge ist im Internat allseits
beliebt und ein sprachlich begabter Musterschüler obendrein. Als er dann aber seinen Lehrer in einer kritischen Situation als Duckmäuser bezeichnet, bekommt er dessen Rache zu spüren und als er sich in seinen besten Freund verliebt, fühlt sich dieser völlig überfordert. Guillaume wird nach seinem Outing gar des Missbrauchs an einem jüngeren Mitschüler bezichtigt, der ihn um Hilfe gebeten hatte. Nicht viel besser ergeht es Guillaumes Schwester, deren Freund ihr eine freie Beziehung
vorschlägt. Als sie dann selbst einen etwas älteren Jungen kennenlernt, gerät auch diese Beziehung, die in eine echte Vergewaltigung mündet, völlig aus den Fugen. So als wollte der Regisseur wenigstens einen Funken Hoffnung lassen, folgt eine dritte Geschichte mit einem ganz jungen Liebespaar in einem Feriencamp, das trotz offener gegenseitiger Sympathie aber nur schwer zueinander findet.
Während man in den bisher erwähnten Filmen mit den jugendlichen Protagonisten mitfühlen
kann, gar echte Empathie entwickelt, fällt das bei der titelgebenden Hauptfigur in Alice T. von Radu Muntean äußerst schwer. Der 15-jährige Teenager ist die Adoptivtochter einer alleinerziehenden Mutter, die selbst schwere Enttäuschungen in ihrem Leben verkraften musste. Aber das allein kann nicht erklären, warum Alice ohne jegliche Konsequenzen von außen aufmüpfig und gewalttätig ist, sich
einen Dreck um die anderen schert, selbst ihre Freundinnen schamlos ausnutzt, keinerlei Respekt gegenüber den Erwachsenen hat und mit offenen Drohungen sogar die Schulleitung schachmatt setzt. Ihre Schwangerschaft, die sie zunächst verheimlicht, bringt ihr dann etwas Nähe und Anerkennung ein, doch da hat sie schon längst eine Abtreibung hinter sich, wobei sie am Ende selbst von ihren Lügen eingeholt wird. Als isolierter Einzelfall taugt Alice nicht, um den Film als mögliche Kritik
an einer allzu permissiven bzw. gleichgültigen rumänischen Gesellschaft oder an einer Jugend ohne Perspektiven zu sehen, zumal der Film keine Ursachenforschung betreibt oder nach möglichen Erklärungen sucht. Für ihre Rolle des kleinen Monsters hat Andra Gu?i jedoch den Preis für die beste weibliche Darstellerin erhalten, was angesichts der vielen herausragenden Frauenfiguren in anderen Filmen dann doch eher überraschte.
Yara, Sibel, Diane und die anderen Frauen
Yara im gleichnamigen Film von Abbas Fahdel hat ihre Eltern durch einen Unfall verloren und lebt in einem von Abwanderung geprägten libanesischen Bergdorf bei ihrer kranken Großmutter. Sie ist das genaue Gegenteil von Alice, aufmerksam und selbstbewusst, wobei auch sie gegen die Regeln der Gesellschaft verstößt, als sie sich auf einen fremden jungen Reisenden einlässt und mit ihm gemeinsam das abgelegene Tal
erforscht. Die aufkeimende Liebe zwischen den beiden wird auf eine harte Probe gestellt, als der Mann sie bittet, mit ihm gemeinsam zu emigrieren.
Ebenfalls in einem kleinen Bergdorf irgendwo in der Türkei spielt der ethnografisch angehauchte Film Sibel von Guillaume Giovanetti und Çagla Zencirci, eine Koproduktion zwischen Frankreich, Deutschland, Luxembourg
und der Türkei, die bereits einen deutschen Verleih gefunden hat, in Locarno den Preis der FIPRESCI und der Ökumenischen Jury gleichermaßen sowie einen 2. Preis der Jugendjury erhielt. In diesem Bergdorf unterhalten sich die Menschen über große Entfernungen hinweg in einer ausdifferenzierten Pfeifsprache. Sibel, die ältere Tochter des Bürgermeisters, ist stumm, kann sich nach einer Krankheit in der Kindheit nur in dieser Vogelsprache ausdrücken und wird im Dorf als
Außenseiterin gemieden. Um endlich die ersehnte Anerkennung zu finden, streift Sibel fast täglich durch die Wälder, um einen Wolf zu erlegen, der angeblich das Dorf bedroht, von den Männern aber nur erfunden wurde, um die Frauen daran zu hindern, das Dorf zu verlassen. Als Sibel auf ihren Streifzügen einen verwundeten Mann entdeckt, der den Militärdienst verweigert hat und von der Polizei gesucht wird, beginnt sie durch diese Begegnung sich selbst und die Umwelt plötzlich mit ganz
anderen Augen zu sehen. Die beeindruckend gespielte, mitunter vielleicht etwas vorhersehbare Geschichte einer Emanzipation und des Umgangs mit dem Fremden handelt von Grenzen aller Art und Möglichkeiten der Kommunikation, wobei auch die politische Dimension nicht ausgespart bleibt.
Diane im gleichnamigen Debütspielfilm von Kent Jones wird überzeugend verkörpert von der erfahrenen US-Schauspielerin Mary Kay Place. Diane aus Massachusetts hat sich ihr Leben lang für
andere eingesetzt und aufgeopfert, nicht zuletzt für ihren schwer drogenabhängigen Sohn, der sich am Ende einer fundamentalistisch geprägten christlichen Sekte anschließt und daraufhin seine Mutter bekehren will. Diane fühlt sich einsam und ausgebrannt, obwohl sie ständig von Menschen umgeben ist, die ihr wohlgesonnen sind und ihre Hilfe dankbar annehmen. In einer Mischung aus Gegenwart und Vergangenheit lässt der Film das Leben dieser gereiften Frau Revue passieren, die erst
im Alter wirklich zu sich selbst findet.
Nicht zuletzt passt auch der italienische Beitrag Menocchio von Alberto Fasulo in die Rubrik mit starken Frauenfiguren. Nach einem authentischen Fall von Inquisition Ende des 16. Jahrhunderts in Italien wird ein einfacher Müller aus einem abgelegenen Bergdorf der Ketzerei beschuldigt, weil seiner Erfahrung nach die Jungfrau Maria ihr Kind nur durch eine normale Schwangerschaft zur Welt bringen konnte. Der Müller
unterschätzt dabei die Gefahr, die ihm und der Familie seitens der Kirche droht, aber er kann sich voll auf seine Frau verlassen, die fest zu ihm h ält.
Ambivalentes aus Deutschland
Gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht. Das trifft in besonderer Weise auf den deutschen Wettbewerbsbeitrag Wintermärchen von Jan Bonny zu. In Anspielungen auf Heinrich Heine, das »Sommermärchen« der Fußballweltmeisterschaft 2006, den vom Regisseur genau verfolgen NSU-Prozess gegen Beate Tschäpe und den am Ende des Films zitierten
Text des Liedes »Schrei nach Liebe« der Musikgruppe »Die Ärzte« geht es in dem provokativ angelegten Film um eine dreiköpfige rechte Terrorzelle, die sich auf sadomasochistische Weise selbst zerfleischt und in einer Serie brutaler Morde gegenüber Migranten einen Akt der Selbstbefreiung sieht. Den gefährlichen Klischeevorstellungen und allzu einfachen Erklärungsmustern der rechtsextremen Szene über Ausländer und Migranten lässt sich aber nicht auf dem gleichen platten Niveau
begegnen mit dramaturgisch überspitzten Klischees über die psychischen und pathologischen Defekte von Rechtsextremen, die in Wirklichkeit viel breiter aufgefächert ist. Ein besonderer Erkenntnisgewinn oder wenigstens ein Ansatz zur weiteren Reflexion, wie es dem später von den Toten Hosen gecoverten Lied vielleicht noch ansatzweise gelingt und im Bereich des Films Kriegerin von David
Wnendt vor einigen Jahren sogar glückte, lässt sich aus den schwer konsumierbaren und breit ausgetretenen Macht-, Sex- und Gewaltszenen in Bonnys Films jedenfalls nicht ziehen.
Die psychologisch verbrämte Konstruktion geistig und seelisch aus dem Gleichgewicht geratener Figuren scheint derzeit wohl ein Problem des deutschsprachigen Films insgesamt zu sein. Im auf der Piazza uraufgeführten neuen Film Was uns nicht umbringt von Sandra Nettelbeck steht erneut ein Psychiater im Mittelpunkt, der sich in eine seiner Patientinnen verliebt und auf diese Weise auch anderen Patienten nicht mehr gerecht werden kann, die alle ein bisschen »bluna« sind. In den Rollen durchweg gut gespielt, verliert sich der Film in zu vielen Nebensträngen und wird auch dadurch nicht wirklichkeitsnah, indem sich wie durch ein Wunder am Ende alle Konflikte in Luft
auflösen. Deutschland, oh Wunderland! – Ähnlich blutleer und zu konstruiert wirkt der Schweizer Wettbewerbsbeitrag Glaubenberg von Thomas Imbach über eine inzestuöse Liebesbeziehung zwischen Bruder und Schwester, die von der Umwelt genau registriert, aber offenbar völlig ignoriert wird.
Zur Ehrenrettung des deutschen Films gab es in der Reihe »Cineasti del presente« das Erstlingswerk von Eva Trobisch mit dem fast programmatisch klingenden
Titel Alles ist gut: Der bereits auf dem Filmfest München ausgezeichnete Film erhielt in Locarno den Preis für den besten Debütfilm und handelt von einer selbstbewussten, beruflich erfolgreichen jungen Frau, die unter Alkoholeinfluss, aber eindeutig gegen ihren Willen von einem ehemaligen Schulkameraden und jetzigen Teamkollegen vergewaltigt wird und nun schwanger ist. Unbegreiflich,
dass ihr so etwas passieren konnte und selbst wenn sich der Täter reumütig entschuldigte, wähnt sie sich weiterhin in der Rolle der starken Frau, die das alles einfach wegstecken kann, bis sie von ihrem Trauma brutal eingeholt wird.
Vorgefundene Realität
Ohne seine Dokumentarfilme wäre auch das Festival in Locarno nur halb so gut. M von Yolande Zauberman und damit der zweite von einer Frau gedrehte Wettbewerbsfilm gewann den Spezialpreis der Jury. Er wagt sich an eines der letzten großen Tabuthemen in ultraorthodoxen jüdischen Gemeinden, nachdem vor einigen Jahren bekannt wurde, dass auch Ultraorthodoxe schwul sein können, warum auch nicht? Doch Menahem Lang,
der in der streng religiösen Gemeinde von Bnei Berak aufwuchs und ein mustergültiger Talmudschüler und Sänger war, wurde als Kind systematisch von einem Rabbiner und anderen Gemeindemitgliedern vergewaltigt und – wie sich im Verlauf des Films herausstellt – er war alles andere als ein Einzelfall. Jahre später sucht er im Rahmen des Films die Orte seiner leidvollen Erfahrungen erneut auf und möchte seine Peiniger zur Rede stellen. Aber nicht aus Rache, sondern um
endlich Ruhe zu finden und den Teufelskreis zu durchbrechen, in dem so viele Menschen immer noch gefangen sind. Ein thematisch beeindruckender Film, mit Handkamera gedreht, oft mitten in der Nacht und auch sonst von schwarzen Flächen und Gewändern geprägt, in denen das Licht und die hellen Gesichter zwar klein, aber umso deutlicher hervortreten. Ein Film auch als gelungene Selbsttherapie und mit einer großen Geste der Versöhnung.
Das Thema des sexuellen Missbrauchs findet sich
natürlich nicht nur in jüdischen Gemeinden. Eine angehende Nonne aus Berlin wurde in einem Priesterseminar in unmittelbarer Nähe des Papstes in Rom systematisch vergewaltigt, bis sie einen Weg fand, sich aus dieser Opferrolle zu befreien, wenn auch ohne päpstliche Unterstützung. Dies ist eines von vier exemplarischen ausgewählten Frauenschicksalen aus westlichen, fernöstlichen und afrikanischen Ländern in Barbara Millers Dokumentarfilm #Female
Pleasures – der nebenbei ein komplett ausverkauftes Kino bescherte. Um weibliche Freuden ging es dabei nicht, vielmehr um den Kampf um Gleichberechtigung und gegen die bis heute andauernde systematische Unterdrückung der weiblichen Sexualität überall auf der Welt, sei es durch genitale Beschneidung oder die in Japan noch unter Strafe gestellte Abbildung des weiblichen Geschlechtsorgans, während der Phallus offiziell verehrt wird und Jung und Alt genussvoll am
Eis in Form eines Phallus lecken.
Zwei herausragende französische Dokumentarfilme dürfen an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben: L’Époque von Matthieu Bareye lässt nach den Terroranschlägen in Frankreich über einen Zeitraum von drei Jahren hinweg Jugendliche, die auf der Straße protestieren und sich nach einer besseren Gesellschaft sehnen, ausführlich zu Wort kommen – Einheimische wie Zugereiste gleichermaßen. Dabei gelingt es dem
Film, etwas von der Wut und Frustration, aber auch von der Kraft und der Hoffnung dieser Generation einzufangen.
Und nach dem Preisträgerfilm aus der »Semaine de la critique« Le Temps des forêts von François-Xavier Drouet wird man jeden Wald mit vollkommen anderen Augen betrachten, wobei die alte Redewendung, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen zu können, hier eine völlig neue brisante Bedeutung gewinnt, die den lebensnotwendigen Schutz des Waldes ad
absurdum führt. Große Teile des Waldes zumindest in Frankreich sind ökologisch bereits eine Wüste ohne jegliches Leben, längst kein erhaltenswerter Rückzugsort mehr für Tiere und Menschen. Nur noch eine ausschließlich auf Gewinnmaximierung angelegte Nutzfläche, deren Verwertung ganze Arbeitsplätze und Existenzen vernichtet. Ein ökologisch intakter Wald – vielleicht bald nur noch im Kino zu sehen.
- 71. Locarno Festival – unser Special im Überblick