»Ich will das jetzt nicht als Purismus verstanden wissen« |
 |
|
| Enthält gewissermaßen das ganze Kino in sich: John Ford in Peter Bogdanovichs Directed By John Ford (1971) | ||
Alexander Horwath, Leiter des Österreichischen Filmmuseums, über die Viennale-Retrospektive, die »Mission« seines Hauses und das zwiespältige Gefühl – Ein Interview in vier Kapiteln
Ein frühlingshafter Tag, an dem man auf dem Platz vor der Albertina sitzen kann, wo das Österreichische Filmmuseum beheimatet ist. Es ist der vorletzte Tag der Viennale, der November hat gerade begonnen. Alexander Horwath nimmt sich an diesem Mittwoch Nachmittag Zeit für ein Gespräch. 2002 trat er die Nachfolge der in Pension gehenden Direktoren und Gründer des Österreichischen Filmmuseums, Peter Konlechner und Peter Kubelka, an und ist seitdem dessen alleiniger Direktor. Von 1992-1997 war Horwath außerdem – in den ersten drei Jahren zusammen mit dem soeben verstorbenen Wolfgang Ainberger – Leiter der Viennale und wurde dann von Hans Hurch abgelöst, der sie zumindest bis 2016, so lange geht sein derzeitiger Vertrag, leiten wird. Das Gespräch wird eine Unterhaltung über Grundsätzliches. Das Österreichische Filmmuseum feiert dieses Jahr sein 50jähriges Bestehen, und Horwath hält viele Anekdoten parat. Im Hintergrund bleiben die Presseaufreger der letzten Tage anlässlich der Neueröffnung der Spielstätte des Filmarchivs Austria im neu umgebauten Metro-Kino. Horwath nimmt es gelassen.
Am Ende unseres fast dreistündigen Treffens geht Peter Konlechner über den Platz. Schlohweißes Haar, würdevoller Gang, heller Trenchcoat: einer, der die Wiener Kultur maßgeblich mitgeprägt hat. Konlechner, den man nur selten sieht. Der Geist des Filmmseums. Ich blicke ihm nach und staune ein wenig.
Das Gespräch führte Dunja Bialas.
1. Offene Motivlagen – Die Tradition der Viennale-Retrospektive // 2. Keine Faksimiles – Filmmuseumsarbeit im Zeitalter der Digitalisierung // 3. Nicht immer nur den Idealistentrupp spielen – Finanzierung und recognition in Österreich // 4. Unterschiede und Spezifika – Zwei Archive in Wien
1. Offene Motivlagen – Die Tradition der Viennale-Retrospektive
artechock: Das Österreichische Filmmuseum ist seit 1966, zwei Jahre nach seiner Gründung und sechs Jahre nach Gründung des Wiener Filmfestivals, mit einer eigenen Retrospektive fester Bestandteil des Viennale-Programms. Wie kam es zu der Einbindung des Filmmuseums in das Festival?
Alexander Horwath: Die erste Retrospektive, die das noch junge Filmmuseum für die Viennale ausgerichtet hat, waren die Marx Brothers. Ein perfekter Auftakt, da Groucho Marx selbst nach Wien kam. Es war ein unfassbarerer Publikums- und Medienerfolg, selbst die ganz seriösen Medien wie „Die Presse“ oder die „NZZ“ schrieben begeistert, dass ganz Wien von den Marx Brothers infiziert sei. Das hat sich im Grunde bis heute gehalten, denn das Filmmuseum begann wenig später mit der Tradition, zwischen Weihnachten und Neujahr Filme der Marx Brothers zu zeigen.

Die erste Schau zur Viennale war einer der definierenden Erfolge des Filmmuseums in seinen Anfangsjahren. Das Festival selbst war damals in der Größenordnung noch relativ überschaubar, und die Retrospektive trug wesentlich dazu bei, dass es international wahrgenommen wurde. Ein Weltpremierenfestival zu sein, das war für die Viennale keine sinnvolle Perspektive, und dies ist auch heute noch so. Insofern war die Retro schon von früher Zeit an ein Hauptattraktor des Festivals. Viele internationale Journalisten kamen, die das Festival auch wegen seiner Retrospektive wahrnehmen wollten. Die „Filmkritik“ hat ganze Abordnungen geschickt. Einmal waren sie zu acht da, um die Howard-Hawks-Retro zu sehen, das war 1970. Daraus ist ein ganzes Heft der „Filmkritik“ entstanden. Für das Filmmuseum brachte das den Vorteil, dass die eigene Arbeit rasch eine internationale Öffentlichkeit erhielt. Das wuchs sehr schnell über die nationale und teilweise auch kleinlichen Öffentlichkeit hinaus. Hier in Österreich war ein Teil der Diskussion von der Frage geprägt, ob das Land überhaupt ein zweites Archiv bräuchte. Womit das Filmmuseum gemeint war.
artechock: Was wurde denn damals konkret in Frage gestellt?
Horwath: Die Vorstellung vieler Hofräte und anderer kulturpolitischer Akteure war, dass es in Wien keine Cinephilie gäbe und deshalb auch kein Bedarf an einem Filmmuseum bestünde. Wer solle denn da kommen, hieß es, wir brauchen das nicht, »wir haben eh ein Archiv!« Das Österreichische Filmarchiv, das damit gemeint war – heute das Filmarchiv Austria – wurde 1955 gegründet, das Filmmuseum neun Jahre später. Die Frage, ob dessen Gründung notwendig war, erübrigte sich aber recht schnell, da der Ansturm vom ersten Tag an gewaltig war, ganz egal ob Filme der Avantgarde oder von Kurosawa, in japanischer Originalfassung und ohne Untertitel, gezeigt wurden. Heute kann man sich das überhaupt nicht mehr vorstellen. Das war natürlich in einer Zeit vor der Einführung der VHS, vor der Criterion-Collection und der Online-Welt, sprich, vor der gegenwärtigen Situation, dass Menschen ihre filmgeschichtliche Bildung aus den verschiedensten Sektoren, Segmenten und Anschauungsweisen von Filmen zusammensetzen können.
artechock: Wie kam es dann dazu, dass Sie als Viennale-Leiter eine Retrospektive ausrichten konnten, das Filmmuseum dies sozusagen an eine andere Institution abgab?
Horwath: Die Entscheidung über die Themen der Viennale-Filmmuseum-Retro wurde immer gemeinsam getroffen, soweit ich weiß, aber vermutlich legte das Filmmuseum lange Zeit die Themen autonom fest und das Festival nickte sie ab. Für mich selbst war die Retro immer ein faszinierendes Element des Festivals, und ich war auch abseits der Viennale ein Dauerbesucher des Filmmuseums. Als ich 1992 zusammen mit Wolfgang Ainberger das Festival übernommen habe, trafen wir uns mit Peter Konlechner, um über die Retrospektive zu sprechen, und dabei haben wir auch Themen vorgeschlagen. Als Viennale-Direktor sind mir dann auch die ökonomischen Sorgen des Filmmuseums bewusster geworden, Konlechner hat uns rasch die prekäre Budgetlage seines Hauses vermittelt. Insofern haben wir es auch als Aufgabe angesehen, von der Stadt Wien höhere Sondermittel für die Viennale-Retros zu kriegen, mit denen das Filmmuseum dann arbeiten konnte.
Die erste Retrospektive zu meiner Zeit als Co-Direktor der Viennale handelte vom Subgenre des»Boxkampfkinos«, ein Projekt der beiden Filmhistoriker Christian Dewald und Elisabeth Büttner, das wir Peter Konlechner vorlegten. Im nächsten Jahr, 1993, gab es die große Schau „Aufbruch ins Ungewisse“ über die österreichische Filmemigration, wiederum ein Vorschlag von außen, von Michael Omasta und Christian Cargnelli, die sich schon länger mit dem Thema befassten, zum Teil im Rahmen der Gesellschaft für Filmtheorie (heute: Synema). Wir haben die Retrospektive sehr groß werden lassen, und sie wurde zu einer zweimonatigen Schau.
Wir haben diese Retrospektive sehr groß werden lassen, sie lief über zwei Monate. Und mit Recht hat das Filmmuseum damals höhere Mittel für die Durchführung der Schau erhalten. Hinzu kam eine zweibändige Publikation, ein erstes Standardwerk, bei dem die ganze Thematik »Filmexil und -emigration« für Österreich zum ersten Mal überhaupt systematisch erarbeitet wurde. Das war zur Zeit der Nachwehen der Waldheim-Ära, der ganzen Debatte darüber, wie sich Österreich gegenüber seiner Zeitgeschichte verhält. Sehr verspätet, in den späten 80er, frühen 90er Jahren hat Österreich eine neue – und ehrlichere, wie ich finde – Auseinandersetzung mit der NS-Ära etabliert, und das inkludiert den Umgang mit dem Exil und der Emigration. Das »Einheimsen« derer, die man zunächst vertrieben hatte, als die »großen Österreicher in Hollywood«, Fritz Lang, Billy Wilder, Fred Zinnemann usw., das war ja gang und gäbe. Aber eher verschwiegen wurden die Umstände, warum sie überhaupt emigriert waren! Es genügte der Hinweis darauf, dass sie aus Wien sind. Unser ganzer Stolz. Und natürlich war das auf die prominenten Emigranten fokussiert, nicht auf die Hundertschaften weniger bekannter Filmleute, die es im Exil viel schwerer hatten.

Die politische Dimension, wie sie Günter Peter Straschek oder andere in Deutschland schon früher thematisiert haben, gab es hier nicht. Was das Exil für die österreichische Film- bzw. Kulturgeschichte bedeutet, und welch ein gebrochenes Gelände sie ist, kam dann bei der Retrospektive stark zum Ausdruck. Es waren rund fünfzehn Persönlichkeiten da, darunter Francis Lederer, Amos Vogel, Vanessa Brown. Es war uns wichtig, Personen aus den nicht-regieführenden Bereichen einzuladen, einen Kameramann wie John Alton, Autoren, Schauspieler, Leute, die im Animationsfilm gearbeitet haben oder, wie Amos Vogel, in der Filmkultur. Auch der Produzent und heutige Viennale-Präsident Eric Pleskow war damals unser Gast. Als Die Büchse der Pandora in der Retrospektive lief, trat der 93-jährige Francis Lederer vor den vollen Saal und sprach in altem „Prager Deutsch“ einführende Worte über sein jetziges Leben in Kalifornien und sein damaliges Selbst, vor 65 Jahren. Dann springt das Bild um, und der Film zeigt tatsächlich den 27-jährigen Franz Lederer in der Rolle des Alwa Schön, ein unglaublich fescher Jüngling, der Louise Brooks begehrt. Das war gespenstisch schön! Es war auch sehr interessant zu sehen, dass manche wieder ganz in ihrer alten Liebe zu Wien aufgingen, trotz allem, was ihnen geschehen war. Andere, z.B. Theodore Bikel, wollten die geschichtlichen Prozesse nicht verdrängen. Das war ja auch die Zeit, in der Jörg Haider immer stärker wurde – für Fred Zinnemann war das der Grund, nicht nach Wien zu kommen. Insofern wurde es doch recht politisch. Einige haben sehr freundlich, aber bestimmt gesagt, es sei schön, wie sie hier von vielen jungen und interessierten Menschen begrüßt würden, dennoch fiele es schwer, über den Ring zu gehen und die FPÖ-Plakate zu sehen. Das war noch nicht „gesunkene Geschichte“, es war alles in einem Spannungsverhältnis mit der Gegenwart.
artechock: Hat sich das Filmarchiv damals zu dieser Retrospektive positioniert oder in irgendeiner Form mitgemacht?
Horwath: Ich kann mich an keine Positionierung seitens des Filmarchivs zur Emigrationsfrage im Rahmen der Retrospektive erinnern. Walter Fritz, der bis 1996 Direktor des Österreichischen Filmarchivs war, hatte als Filmhistoriker auch Bände zur österreichischen Filmgeschichte veröffentlicht. Da kam die Emigration durchaus vor, aber mehr am Rande. Das Verständnis der nationalen Filmgeschichte bezog sich vorwiegend auf österreichischen Grund und Boden, auf österreichische Produktionen oder Co-Produktionen, als National Cinematography des Landes. Da kann man nicht ohne weiteres Double Indemnity oder Der Verlorene reinnehmen. Das Filmschaffen der Emigranten kam im Österreichischen Filmarchiv immer wieder vor, aber es gab diesbezüglich keinen Forschungs- oder Sammlungsschwerpunkt.
artechock: Wie stellte sich denn damals das Verhältnis des Filmarchivs zur Viennale dar? Gab es da auch schon gemeinsame Programme?
Alexander Horwath: Das Filmarchiv war damals nicht sehr stark als zeigende Institution tätig. Bis in die späten 1990er Jahre gab es einen kleinen Vorführraum, der ein paar Mal im Monat für Archiv-Vorführungen genutzt wurde. Zusätzlich wurden im niederösterreichischen Laxenburg, wo die Archivgebäude stehen, über den Sommer öfters Ausstellungen und Filmreihen gezeigt, vor allem in den 70er Jahren. Von 1976 bis 1981 gab es, unabhängig von der Viennale-Filmmuseums-Retro, jährlich eine Schau während der Viennale, die der Filmclub „Action“ und das Filmarchiv gemeinsam veranstalteten, in wechselnden Kinos wie dem Bellaria-Kino – z.B. die erste Werner-Hochbaum-Wiederentdeckung in Österreich, 1976.
Es gab generell, soweit ich das beurteilen kann, für das Filmarchiv keinen Anlass für Pikiertheiten angesichts des Umstands, dass die Viennale seit 1966 jedes Jahr mit dem Filmmuseum eine große Retrospektive machte. 1991 lief einmal Die Stadt ohne Juden als Filmarchiv-Restaurierung im Rahmen der Viennale, aber in den Jahren danach hat sich das Filmarchiv nie mit Vorschlägen an das Festival gewendet. Ich kann mich erinnern, dass ich selber 1995 oder 96 als Viennale-Direktor zu Walter Fritz gegangen bin, um anzufragen, ob es da etwas zu zeigen gäbe. Ich habe mich z.B. für Ost und West interessiert – einen jiddischen 20er-Jahre-Film. Aber dabei ist nichts herausgekommen. Diese Haltung des Archivs hat sich dann ab Ende der 90er Jahre sehr schnell verändert.
artechock: Aber Sie haben dann doch noch als Viennale-Direktor eigene Themen für die Filmmuseums-Retrospektive eingebracht?
Horwath: Die drei Retrospektiven 1994-96 waren tatsächlich Projekte, die ich vorgeschlagen und kuratorisch betreut habe. Ich wollte z.B. etwas Mehrteiliges über das postklassische amerikanische Kino machen. Das habe ich Peter Konlechner vorgeschlagen, weil ich fand, dass die 60er und 70er Jahre Hollywoods unterbelichtet waren – was man sich heute kaum noch vorstellen kann. Heute ist New Hollywood unwidersprochen eine zweite Goldene Ära im amerikanischen Kino! 1994/95 fanden diese beiden Retrospektiven statt, in einer Zeit, als es in Amerika dazu noch keine Retrospektiven gab, auch Peter Biskinds Buch „Easy Riders, Raging Bulls“ gab es noch nicht. Es war eine relativ frühe Behauptung, dass man diese Ära genauso ernst nehmen sollte wie die sogenannte klassische Studio-Ära.

artechock: Und es gab eine erste Retrospektiven-Broschüre…
Horwath: 1994 war ich noch zusammen mit Wolfgang Ainberger Leiter, und konnte mehr Arbeit in Publikationen stecken. Die „Cool“-Broschüre zum ersten Teil der Retrospektive war erstmals ausführlicher gestaltet. 1992 hatte es bereits eine intensive Aufbereitung der Viennale-Retro zum Boxkampfkino gegeben, aber die war – leider – noch integriert in den allgemeinen Viennale-Katalog. 1993 wurden zwei Bände im Wespennest-Verlag zur Retro „Aufbruch ins Ungewisse“ publiziert. Dann kam 1994 die „Cool“-Broschüre, 1995 gab es mit „The Last Great American Picture Show“ wieder ein eigenes Buch bei Wespennest, und 1996 mit „Before the Code“ eine Viennale-Publikation zur Retrospektive über die Pre-Code-Ära, also die Jahre vor 1934, vor der Durchsetzung des Hays Code in Hollywood. Ich hab damals in den USA, vor allem im Film Forum in New York, wie verrückt diese Filme „getankt“, da begann man auch, VHS-Tapes unter dem Label „Forbidden Hollywood“ zu veröffentlichen, mit Filmen, die in Europa kaum jemand kannte.
Als Hans Hurch die Viennale übernahm, wurde diese Art von Katalogen zur Retrospektive fortgesetzt. Ab 2006 wurden sie noch „buchförmiger“ und fanden zum heutigen Format. Schon zu meiner Viennale-Zeit hat es sich etabliert, dass die Publikationen komplett von der Viennale betreut werden, sie waren eine Zusatzleistung des Festivals, für die dem Filmmuseum keine Kosten entstanden sind. Während die Schau selber vom Filmmuseum organisiert und finanziert wird.
artechock: Seit 2002 sind Sie Leiter des Österreichischen Filmmuseums und können nun gewissermaßen von der anderen Seite her die Viennale-Retrospektive gestalten. Hat sich die Richtung der Diskussionen verändert in dem Sinne, dass Sie Hans Hurch, der die Viennale schon fünf Jahre vor ihrem Amtsantritt als Filmmuseums-Direktor übernommen hat, Vorschläge für die Retrospektive machen?
Horwath: Seit ich Direktor des Filmmuseums bin, ist es Routine, dass ich mich mit Hans Hurch zusammensetze und wir verschiedene Optionen wälzen. Wir haben in unserer Themenfindung keine Systematik, deshalb ist es etwas schwer, den Prozess genau zu umreißen. Was man vielleicht sagen kann, ist, dass wir beide nicht darauf aus sind, „aktuelle“ Aufreger- oder Polit-Themen allzu buchstäblich in Retrospektiventhemen umzuwandeln.
Uns beiden ist es wichtig, dass wir nicht in diese Gespräche hinein- oder aus ihnen herausgehen mit dem Gefühl, etwas durchgesetzt zu haben. Wir wissen beide, dass das Ganze nur Sinn hat, wenn beide Institutionen froh darüber sind, Rivette, Akerman, Ford, Lang, Jerry Lewis, den Essay-Film, die „Kinostadt“ Los Angeles, Straub/Huillet oder Warhol würdigen zu können. Das ist die Grundlage, die professionelle Basis für die Zusammenarbeit. Sie hat eine außerordentlich lange Tradition und es gibt überhaupt keinen Grund, eine so schöne Tradition weniger schön werden zu lassen.
artechock: Die Interessenslage eines Filmmuseums-Direktor an einer Retrospektive könnte dennoch etwas anders aussehen als die eines Festivalleiters?
Horwath: Für mich ist es sicher einfacher, denn das Arbeitsspektrum eines Filmmuseums umfasst ja die gesamte Filmgeschichte. Ob wir eine große John-Ford-Retro jetzt mit der Viennale zusammen machen oder im Mai 2016, ist für das Filmmuseum relativ egal. Konkret spielt sich das so ab: Wir sitzen zusammen im Café Bräunerhof, jeder macht Vorschläge, manche halten sich eine Weile in der Diskussion, andere werden daheim abgeklopft, über wieder andere beschließen wir, sie sein zu lassen, weil das Thema doch nicht so stimmig erscheint. Es gibt auch praktische Gründe. Wenn zum Beispiel Locarno ein Thema als Retrospektive bringt, über das man selbst nachgedacht hat, wird man es aus nachvollziehbarer Viennale-Sicht nicht mehr machen, für das Filmmuseum wäre das nicht so entscheidend. Die Viennale hat andere Vergleichsgrößen als das Filmmuseum. Unser Gegenüber ist öfter die Landschaft anderer Filmmuseen, manchmal auch in Form von Partnerschaften, um eine bestimmte Schau oder ein Thema in verschiedenen Städten zeigen zu können. Die jeweilige Motivlage für Viennale und Filmmuseum muss jedenfalls offen benannt werden. Manches hat man jahrelang im Gespräch – Jerry Lewis ist so ein Fall, bis es letztes Jahr dann so weit war, die Retro zu machen. Oder ein Thema taucht wieder auf, das wir schon zur Seite gelegt hatten.
artechock: Wäre das 16mm-Programm dieses Jahr auch als Retrospektive des Filmmuseums denkbar gewesen?
Horwath: Das war zuletzt immer wieder im Gespräch, als Vorschlag von Hans Hurch. Ich hielt und halte es für eine gute Idee, was das Festival betrifft, aber für eine Filmmuseums-Retro kam es aus mehreren Gründen für mich nicht in Betracht. Das Filmmuseum thematisiert seit Dekaden die Frage der Materialität des Kinos, den Umstand, dass Formate und Werkzeuge eng mit der Ästhetik und auch mit „soziologischen“ Aspekten des Kinos zusammenhängen. Die „kleinen“ Formate, die Avantgarde, die ephemeren Filmformen spielen dabei eine wichtige Rolle. Insofern wäre eine spezielle vier- oder sechswöchige Thematisierung von 16mm für das Filmmuseum ein bisschen wie die Verdoppelung dessen, was wir ohnehin laufend tun. Wir fokussieren auf die Avantgardegeschichte des 16mm-Films und auf das Thema Amateurfilm, wir laden zeitgenössische Künstler/innen wie Tacita Dean oder Luke Fowler ein, die solche Format- und Materialfragen stark betonen, wir behandeln andere Aspekte des nicht-industriellen Filmschaffens wie Amateurfilm, anonyme Dokumente usw. Schon 1984 hat Peter Kubelka den in Wien stattfindenden FIAF-Kongress (Kongress der International Federation of Film Archives) unter dieses Thema gestellt: »Die Bedeutung des nicht-industriellen Films für unser kulturelles Erbe«. Da wurden nebeneinander Tagebuchfilme von Jonas Mekas, anonyme Amateurarbeiten, Pornos und wissenschaftliche Filme gezeigt, fast alles bewusst Artefakte in 16mm. Oder Trainingsfilme, in denen Sportler zur Verbesserung ihrer Leistung mittels Filmkamera „studiert“ wurden.

Insofern wäre es mir etwas komisch vorgekommen, wenn das Filmmuseum im Rahmen der Viennale noch einmal »erklären« würde, was es mit dem 16mm-Film auf sich hat. Dazu kommt noch, dass die Formate nicht so rein voneinander geschieden werden können. Vieles ist auf 16mm gedreht, aber nur als 35mm-Film öffentlich geworden. Umgekehrt haben Millionen Menschen vor der Video-Ära die 35mm-Filmgeschichte in 16mm-Reduktionskopien zu Gesicht bekommen – da war 16mm ein flexibles Verbreitungsmedium für Werke eines anderen Formats. Von John Cassavetes' Shadows, den filmhistorische Mythen gern als 16mm-Film beschreiben, gibt es tatsächlich eine Urversion auf 16mm, von der Mekas immer sagte, sie sei die innovativere. Aber die kann nicht gezeigt werden. Die bekannt gewordene Version ist auf 35mm aufgeblasen. 16mm ist auch das Format, in das viele 8mm-Filme aufgeblasen und distribuiert wurden. In diesem Sinn muss man sagen: »16mm-Film ist mehr als 16mm-Film«. Es bedürfte einer anderen Art von Kulturgeschichte und anderen Formaten als einer Filmretro, um das wirklich zu umkreisen, insofern fand ich das – fürs Filmmuseum und die Linie der Viennale-Filmmuseum-Retros gesprochen – nicht wirklich vermittelbar.
Gleichzeitig finde ich es wichtig und legitim, das Thema in einer überschaubaren Anzahl von zehn oder zwölf Programmen auf bestimmte Aspekte so herunterzubrechen, dass man eine Vielzahl von Fragen ausklammern kann. So wird das Thema als Programm vermittelbar.
artechock: Was ist, wenn auf der anderen Seite die Viennale Themen ablehnt, die Sie stark interessieren?
Horwath: Wir haben das Glück, solche Themen auch ein paar Monate später als Schauen im Filmmuseum darbieten zu können, wir sind da nicht auf die Viennale angewiesen. Hans Hurch lehnt öfters Themenvorschläge ab, die ihn nicht interessieren und die wir dann eben in anderem Kontext machen, zuletzt z.B. die Retrospektive zum sowjetischen „Tauwetter“-Kino, die ich sehr spannend fand, oder die Schau „The Real Eighties“ zum amerikanischen 80er Jahre-Kino. Das war eine späte und schöne Erweiterung der New Hollywood-Thematik und wurde von einer Berliner Kurator/inn/en-Gruppe, The Canine Condition, erarbeitet. Sie war dann in kleinerer Form auch im Berliner Arsenal und im Züricher Filmpodium zu sehen.
Natürlich kann man sich bei Figuren wie Fritz Lang und John Ford die Frage stellen: Muss das jetzt gerade die Viennale-Retro sein? Weil sie vielleicht nicht wie „außergewöhnliche“ Ideen erscheinen.
Andererseits ist Zwangsoriginalität auch keine Lösung. Ich bin so wie Hans Hurch sehr froh über solche Entscheidungen, denn das sind Figuren, die gewissermaßen das ganze Kino in sich enthalten – womit sie auf jeden Fall auch für ein Filmfestival „gültig“ sind.
artechock: Wie aber fällt dann konkret die Entscheidung für beispielsweise die John-Ford-Retrospektive? Ist die Kopienlage ein Entscheidungskriterien für die Durchführung einer Retro?
Horwath: Nein. Wenn wir die Retro entscheiden, wissen wir in sehr vielen Fällen noch gar nicht, wie die Kopienlage sein wird. Deshalb gibt es auch von meiner Seite immer den Wunsch, das möglichst früh entschieden zu haben.
artechock: Wann wird die Retro entschieden, und wie sieht es dann mit der Realisierbarkeit aus?
Horwath: Manchmal beschließen wir das endgültig erst nach Cannes, also Ende Mai, Anfang Juni, manchmal auch schon im April, aber nie früher. Nur 2003 war das anders, als die „Art Theatre Guild“-Retro schon eineinhalb Jahre im Voraus feststand, eine Idee des Kurators Roland Domenig, der das Terrain sehr gut kannte und recherchiert hatte.
Die tatsächliche Kopienlage wird also erst deutlich, wenn wir zu arbeiten beginnen. Bei der letztjährigen Retro zu Jerry Lewis hatte ich aber schon vorher das Gefühl, dass es schwierig werden würde. Die meisten seiner Filme hat Lewis für Paramount gemacht, wo es keine sehr aktive Restaurierungs- bzw. Archivabteilung gibt – anders als bei Sony oder Fox, die darauf achten, dass ihre Studio Library in ordentlicher, restaurierter Form auch für Kinematheken verfügbar ist. Bei Paramount weiß man nie, was einen erwartet, und so war es dann auch. Sie konnten uns zwar die Aufführungsrechte geben, aber keine einzige Kopie dieser riesigen Jerry-Lewis-Schau kam von Paramount. Im „besten“ Fall, der für uns aber nicht in Frage kommt, bieten sie Blu-rays oder DCPs (Digital Cinema Packages) an.
Michael Pogorzelski, der Leiter des Academy Film Archive hat mir damals gesagt, dass die Lewis-Retro eine case study werden würde: ob man im Jahr 2013 noch eine Filmretrospektive im Originalformat machen kann, oder ob das grandios scheitert. Wir haben es glücklicherweise geschafft und konnten alle ausgewählten Filme zeigen. Wir mussten auf keinen Film verzichten, weil er nicht im Originalformat ausfindig zu machen war.
2. Keine Faksimiles – Filmmuseumsarbeit im Zeitalter der Digitalisierung
artechock: Wenn also ein Film nicht im Originalformat vorliegt, wird er nicht gezeigt?
Horwath: Ja, das ist unsere Politik. Ich weiß, dass das nicht überall so ist, auch an manchen renommierten Stätten hat sich diese Haltung in den letzten Jahren verändert. Oft wird argumentiert, dass dies ein Wunsch des Publikums sei, das primär am Filminhalt und nicht am Format interessiert sei. Und man sehe ja auch auf DVD und online Filme. Alles schön und gut – und jeder wie er meint. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass eine solche Praxis für ein Museum nicht in Frage kommt. Wenn man eine andere Art von Haus ist, und sich auch nicht „Museum“ nennt, dann führt das vielleicht zu einer anderen Definition der eigenen Mission. Aber ein Haus, das als Museum und innerhalb eines entsprechenden öffentlichen Auftrags und Bewusstseins auftritt, sollte transparent und ehrlich sein und dem Publikum nicht laufend Faksimiles präsentieren, so als ginge es in der Kulturgeschichte nur um irgendwelchen „Content“. Was ich also für problematisch halte, ist vor allem der nichttransparente Umgang mit der materiellen Geschichte einer Ausdrucksform.
Ich möchte das nicht als Purismus missverstanden wissen. Das wäre auch absurd, angesichts der Vielzahl von Möglichkeiten, Filme in allen möglichen Varianten zu sehen. Es wird ja keinem Menschen verboten, Filme so zu sehen, wie er oder sie möchte. Man muss sich eher fragen, wieso die wenigen verbleibenden Häuser, die Bewegtbilder so präsentieren, wie es deren jeweiliger historischer Realität zum Zeitpunkt der Veröffentlichung am ehesten entspricht, als „Puristen“ abgekanzelt werden. Das ist eine sehr seltsame Entwicklung der Diskurse. Es geht auch nicht im Mindesten darum, die Werke, die in jüngeren Medien oder Formaten geschaffen wurden, irgendwie fernzuhalten. Natürlich zeigen wir aktuelle Werke, die so produziert und veröffentlicht worden sind, als DCP, als File oder als Video. Es geht im Museum einfach nur um ein Transparenz- und Vertrauensverhältnis, sowohl gegenüber den Betrachtern als auch gegenüber den Werken und ihrer historischen Wirklichkeit, also der technisch-ästhetischen Konstellation, in der sie gemacht und gedacht und veröffentlicht worden sind. Ein „Cinéastes de notre temps“-Film, der in den 60er Jahren fürs französische Fernsehen gemacht und dort ausgestrahlt wurde, kann durchaus auf Video wiedergegeben werden. Korrekterweise müsste man ihn sogar auf einem Monitor zeigen! Da gibt es unendlich viele „unreine“ Verhältnisse. Es geht nicht darum, eine hundertprozentige Reinheit zu behaupten. Es geht darum, Leute möglichst transparent über die Umstände aufzuklären, in denen sich Bildgeschichte abgespielt und die Öffentlichkeit erreicht hat, weil diese materiellen, technischen Aspekte auch für die Werke selbst, für ihre ästhetische Form von beträchtlicher Bedeutung waren. Das sollte man als Museum wiedergeben können.
artechock: Das Museum also als permanenter Ort der Reflexion dessen, was es tut, und warum es dies tut…
Horwath: Ja, genau. Das prägt auch unsere Vermittlungsarbeit mit Kindern und Lehrern, in den „Summerschools“, wo wir Lehrern, die mit Bewegtbild arbeiten wollen, Module in die Hand geben. Wir achten darauf, das mediale Unterscheidungsvermögen zu stärken, weshalb alle Veranstaltungen im Kinosaal stattfinden. Die digitale Ära hat eine so starke Tendenz, alles, auch die historischen Werke, auf dasselbe Display und denselben „Code“ hin zu rendern, als hätten die Bilder keine Geschichte. Als gäbe es keinen Unterschied zwischen neu entstandenen Bildern, die im und für das digitale Medium produziert sind, und älteren Bildern, die mit anderen Werkzeugen und damit auch in einem anderen Denken entstanden sind. Ein Geschichtsbewusstsein, in dem Unterscheidungsvermögen hoch gehalten wird, erlaubt es, die unterschiedlichen Herkünfte, Praktiken und Denksysteme zu verstehen, die sich mit kulturellen Artefakten verbinden. Diese Fähigkeit, nämlich unterscheiden zu können, ist meines Erachtens überhaupt eine zentrale Frage für die Demokratie. Und das kann man eben auf unserem kleinen Gebiet des Films zu befördern versuchen. In den Vermittlungsveranstaltungen reden wir nicht einfach „inhaltistisch“ über Filme, wie zum Beispiel Brokeback Mountain, damit die Lehrer mit ihren Schülern über Homosexualität diskutieren können. Die Medienpädagogik im deutschsprachigen Raum ist zu 98% von solchen Sichtweisen geprägt. Umso mehr sehen wir unsere Aufgabe darin, das Medium als solches zu thematisieren und möglichst mit diversen Fragezeichen zu versehen. Was ist der Film, wozu führt dieses technisch-ästhetische System namens Kinematographie?
Wir machen auch jedes Semester eine Uni-Veranstaltung, damit angehende Filmwissenschaftler eine gewisse Idee davon erhalten, was Film Studies jenseits der Beschränkung auf die zeitgenössischen medialen Verwandlungen sein könnten. Eigentlich müsste ja der projizierte Film ein zentrales Thema in dieser Disziplin sein, de facto ist es aber fast ausschließlich der „textuell“ gemachte, buchförmige Film, mit dem das Studium betrieben wird – der Film zum Vor- und Zurückblättern wie in der Germanistik: der Film als DVD oder online-File. Ich bin natürlich nicht dagegen, sich eine Ford-Szene shot by shot und immer wiederanzusehen. Aber die Film Studies wären eine viel interessantere Disziplin, wenn sie sich verstärkt dem Umstand stellen würden, dass weite Teile der Filmgeschichte aus Werken bestehen, die vergingen, während man sie sah.
Historisch gesehen ist die Kultur des Films und seine Prägekraft bis weit in das 20. Jahrhundert hinein markiert durch Geschehnisse, die sich verbrauchen, während sie stattfinden – in der Zeit ihres Erscheinens, der Projektion. Das zu verstehen bzw. mit dieser besonderen Zeitlichkeit auch wirklich umzugehen, haben die Film Studies nur rudimentär geschafft. Ihre Durchsetzung als akademische Disziplin fand statt, als der Film bereits „buchförmig“ verfügbar wurde.
artechock: Lehnen Sie aus dieser kulturellen Haltung heraus digitale Formatierungen historischer, auf Filmmaterial entstandener Filme ab?
Horwath: Wenn Sie ins Kunsthistorische Museum gehen, sollten Sie auch in Zukunft erwarten können, dass dort die Brueghels wirklich an der Wand hängen. Das heißt natürlich nicht, dass es keine Kataloge geben soll, in denen die Brueghels reproduziert sind. Deshalb gibt es bei uns DVDs, in der »Edition Filmmuseum«, das ist für uns das Äquivalent für einen sorgfältig editierten Katalog zu einer Ausstellung in einem Museum der Bildenden Kunst. Auch das ist Unterscheidungsvermögen. Natürlich soll man Klassenverhältnisse auch auf DVD sehen können. Aber das soll nicht dazu führen, dass die Leute meinen, das wäre es auch schon komplett gewesen. Wir laden sie dezidiert dazu ein, das Ereignis der Filmprojektion ebenfalls wahrzunehmen oder nachzuholen.
Für diese Art von Bewusstseinsschärfung ist ganz entscheidend, wie transparent das Präsentationsformat gemacht wird. Filme auf Blu-ray kann ich auch daheim ansehen, deshalb muss ich nicht ins Filmmuseum gehen.
artechock: Die Brillanz der gezeigten Kopien bei der diesjährigen John-Ford-Retro hat mich hingegen schlichtweg umgehauen. Wie schwierig ist es, solche tollen Kopien ausfindig zu machen?
Horwath: Es wird nicht unbedingt leichter. Die jüngste studio policy geht oft dahin, dass ein DCP angeboten wird, selbst wenn noch wunderbare Filmkopien vorliegen. Es wird also in Zukunft immer mehr zu Engpässen kommen. Es ist eine Frage, wie viel Zeit man der Kopienbeschaffung widmet und wo man spart. Wir müssen an allen Ecken und Enden sparen, aber wir sparen nicht dabei, Kopien aus entlegenen Ländern, Archiven und von Sammlern herbeizuschaffen. Manchmal auch zwei, um sie zu vergleichen. In einzelnen Fällen muss man auch eingestehen, dass sich keine bessere Kopie finden ließ, auch dies sollte transparent gehalten werden. Besser, die Leute bekommen eine Kopie zu sehen, die die Spuren ihres Lebens preisgibt, als dass das Format und die Kopienlage nicht thematisiert werden.
Es geht darum, Beziehungen zu den Studios zu etablieren, wo gegenseitiges Vertrauen herrscht und unsere Arbeitsweise auch respektiert wird. Wir sind mittlerweile einer der wenigen Orte, die noch so arbeiten, das hat sich mittlerweile herumgesprochen, und wir müssen immer weniger E-Mails dahingehend beantworten, dass wir leider keine Blu-ray oder DCP spielen. Natürlich versuchen wir auch auf Festivals wie Bologna und Pordenone und insgesamt in der Fachwelt unsere Haltung zu artikulieren.

artechock: Interessant war es auch, die rotstichige Kopie zu sehen von Peter Bogdanovichs Directed By John Ford, im Vergleich zu den farbensatten Ford-Filmen der Retro…
Horwath: Der Kompilationsfilm von 1971 enthält die damals verwendeten Ford-Filmausschnitte, die nun mitverblasst sind, während die Filme von Ford in der Zwischenzeit meist restauriert oder neu kopiert worden sind. So lassen sich auch die verschiedenen „Zwischenstände“ der Filmgeschichtsschreibung in einem Filmmuseum darstellen.
Filmmuseen können die Haltung einnehmen, dass sich die Dinge gewissermaßen von selbst verstehen, ohne dass die eigene Rolle als Vermittler problematisiert und die eigenen Positionen laufend thematisiert werden. Vielleicht hält man es auch für eine Gefahr, diese Hintergründe zu problematisieren, weil man befürchtet, das könnte die Besucher nicht interessieren. In unserem Fall ist das schon aufgrund der Institutionsgeschichte etwas anders, denn Peter Kubelkas Verhältnis zum Kino war stark vom unabhängigen, nichtindustriellen Film geprägt – und nicht vom »illusionistischen« Verständnis des Films wie in der Filmindustrie. Der Film ist hier nicht das »problemlose« Fenster zu irgendeiner Wirklichkeit, sondern etwas, das seine Rahmungen mitdenkt. Es stand hier von Anfang an die Konkretheit des filmischen Ereignisses im Mittelpunkt, und nicht der Mythos Kino, wie ihn die Filmindustrie bewirbt. Darum sind auch viele sogenannte marginale Positionen der Filmgeschichte immer Teil der hiesigen Präsentationen und Sammlungen gewesen.
Ein anderer Aspekt dieser Betonung des Rahmens, der „Maschine Kino“ und der Qualitäten der Filmwahrnehmung war Peter Konlechners intensiver Versuch, Weltklassebedingungen zu schaffen, was die Vorführungen betrifft, bei aller Limitiertheit der Mittel. Er kam von der TU, vom Studium der Nachrichtentechnik, und hatte große Kenntnisse über die technische Seite des Mediums, auch was den Filmton betraf. Auch dies der Versuch einer Bewusstmachung: dass es verschiedene Qualitäten geben kann. Der Akt eines Museumsbesuchs muss ja nicht nur den Genuss der dort ausgestellten malerischen oder filmischen Illusion beinhalten, sondern auch die besondere Freude, dass man des Artefakt-Charakters gewahr wird, den jegliche Museumsdarbietung mit sich bringt. Beides kann außerordentlich pleasurable sein. Man hat mit jedem Museumsbesuch, wenn man ihn erst nimmt, eine konkrete und doppelte Erfahrung, wie beim Besuch des „Unsichtbaren Kinos“ im Filmmuseum.
Man kann es auch mit dem Besuch eines Konzertsaals vergleichen, nicht im Sinne eines elitären, hochkulturellen Konzepts, sondern als eine in der Zeit ablaufenden Erfahrung an einem konkreten Ort, zu einem konkreten Zeitpunkt, die von einem Werk in bestimmter Dauer vorgegeben wird. Diese Dauer an einem festgelegten Ort zu einer bestimmten Tageszeit mit anderen geteilt zu haben, ist eine Erfahrung, die natürlich nicht dieselbe ist, wie einen Schauspielerkörper auf der Theaterbühne oder einen Musikerkörper auf der Konzertbühne erlebt zu haben. Aber es hat doch in vieler Hinsicht etwas von diesen vorbeigehenden Ereignissen. Und es beinhaltet eben nicht nur die Erfahrung von „Content“, sondern die Erfahrung einer spezifischen, materiellen Wirklichkeit, die nicht ablösbar ist vom sogenannten Inhalt der Kunst, um die es gerade geht.
Je besser es gelingt, diese Art von Gedanken über das Medium Film mit bewusst zu machen, desto eher glaube ich, dass ein Filmmuseum seiner Aufgabe nachkommt und dazu beitragen kann, dass der Film in seinen medialen Eigen- und Besonderheiten überliefert wird. Anstatt sich damit zu begnügen, das Medium Film ausschließlich faksimiliert zu überliefern. Bei anderen Künsten, Ausdrucksformen und Kulturtechniken der Menschheitsgeschichte sind wir selbstverständlich davon überzeugt, dass es nicht nur wichtig ist, möglichst viel digitalen access zu bieten, sondern dass es auch eine wesentliche Aufgabe ist, die historischen Werke in ihrem ursprünglichen materiellen Charakter zu bewahren und zugänglich zu halten. Was den Film betrifft, scheint Letzteres hingegen für viele Menschen müßig zu sein.
Der Film, der 120 Jahre der Menschheitsgeschichte massiv geprägt hat, bis weit in das gesellschaftlich-politische Verständnis der Menschen und ihre Wahrnehmungsweisen hinein, könnte die erste Kulturtechnik sein, bei der es kulturpolitisch nicht für notwendig gefunden wird, sie auch als solche zu überliefern, und sei es nur an zehn Orten der Welt. Um das 20. Jahrhundert, seine Getaktetheit und seinen Zeit- und Geschichtsbegriff verstehen zu können, muss man, so behaupte ich, das prägende Medium des Jahrhunderts verstehen können. Das ist der Grund für meine Haltung gegenüber dem Filmmaterial. Nicht ein Fetischismus, nicht die Aura, sondern etwas, das für alle kulturgeschichtlichen Auseinandersetzungen gilt: Hat man die Kulturtechniken nicht mehr parat, kann man die betreffende Epoche nicht mehr verstehen.
artechock: Ihre Position als Filmmuseumsleiter ist ja mittlerweile eher rar, wenn nicht sogar einzigartig geworden. Denken Sie, dass Ihre Haltung auch so etwas wie eine Gewährleistung darstellen kann: Solange es Spielstätten wie das Österreichische Filmmuseum gibt, wird es auch noch Filmkopien geben, die für den Einsatz dort verfügbar gehalten werden? Impliziert Ihre Haltung auch ein Bewahren vor dem Verschwinden?
Horwath: Das hofft man natürlich, aber es braucht sicher mehr als nur eine oder wenige Institutionen und Initiativen dieser Art. Die Savefilm.org-Kampagne, begonnen von Tacita Dean und Guillermo Navarro, ist so ein Beispiel. Da sind mehrere relevante Filminstitutionen wie das George Eastman House aktiv mit dabei, und zum Glück auch viele renommierte Kunstmuseen. Ich glaube mittlerweile, dass es die Filmmuseen alleine nicht schaffen. Christopher Nolan und Quentin Tarantino können die Studios dazu bringen, mit Kodak Vereinbarungen zu treffen, damit weiterhin eine gewisse Bandbreite von Filmstocks produziert wird – dies ist heuer im Frühjahr gelungen. Die Filmmuseen sind zu schwach und kommerziell zu irrelevant, um dies bewirken zu können. Über bildende Künstler, die mit Film arbeiten, ist es auch möglich geworden, dass viele angesehene Kunstmuseen bei dieser Kampagne mitmachen, wie das Metropolitan Museum in New York, das Musée d’Art Moderne in Paris oder das LACMA in Los Angeles.
Ich hoffte immer, dass der Film überleben kann als eine Kulturtechnik, die nicht „hochkulturell“ werden muss. Aber genau das passiert jetzt natürlich, so wie es etwa mit der Oper passiert ist, die auch einmal ein „popkulturelles“ Medium war. Übriggeblieben ist ein hochpreisiges, von bestimmten, besonderen Häusern der Welt angebotenes Großereignis. Wenn es denn gelingt, den Film zu überliefern, dann wird dies durch die Kunstmuseen, durch sogenannte elitäre, hochkulturelle Diskurse geschehen. Was schon ein Erfolg wäre, wenn auch nur ein halber, weil in diesem Prozess sicher auch viel an Kenntnissen verloren gehen wird, was den nicht-„hochkulturellen“ bzw. nicht-kanonischen Film betrifft. Man wird sehen, wie stark die Verarmung des filmgeschichtlichen Bewusstseins in 50 Jahren sein wird, ob es noch möglich gewesen sein wird, Filmgeschichte in einer großen Bandbreite zu erhalten, so dass man auch weiterhin nebeneinander John-Ford-Filme, Avantgarde-, Dokumentar-, und Werbefilme, Kunstfilme und Slasherfilme sehen kann. Und eben nicht nur drei Bergmans, drei Fellinis und drei Fritz Langs. Ich erwarte das durchaus mit gemischten Gefühlen. Ich bin sehr dankbar über die Savefilm-Initiative und sehr froh über Leute wie Nolan und Tarantino, die aus ihrer praktischen und cinephilen Erfahrung zur Erkenntnis über die Überlieferungsproblematik kommen und die ihre einflussreiche Rolle in Hollywood sinnvoll nützen, um Druck auf die Industrie auszuüben, damit weiterhin Rohfilm hergestellt wird, denn das ist ein entscheidender Faktor.
Es gibt aber auch noch eine andere Entwicklung. Die Firma Ferrania hat eine Kickstarter-Kampagne gestartet und es sind in kürzester Zeit mehrere Hunderttausend Dollar für die Erneuerung eines Produktionbetriebs für analoges Film- und Fotomaterial zusammengekommen. Entweder man vertraut darauf, dass Hollywood und Eastman/Kodak dafür sorgen, dass es weiterhin Film gibt: das ist der Nolan/Tarantino-Weg. Ob da auch intermediary stocks für die analoge Konservierung mitabgedeckt sein werden oder der Bedarf einer Künstlerin wie Tacita Dean, das ist die Frage. Der andere Weg ist der vieler kleiner Laboratorien, die in den letzten Jahren entstanden sind, wie L’Abominable in Paris. Das sind sozusagen artisanale Workshops und Vereinigungen für eine „subkulturelle“ Überlieferung von Film, wo nicht nur Filmkunst entsteht, sondern auch an Emulsionen und Kopiertechniken gearbeitet wird, weil man dort verstanden hat, dass man die Kinemtografie im Ganzen, inklusive der Technologie überliefern muss. Das inkludiert die Herstellung von Filmstocks in kleinerer Dimension, für eine Klientel, die sich ernsthaft darauf vorbereitet, auch in den nächsten Jahrzehnten Film nicht einfach vom Erdboden verschwinden zu lassen.

Bei früheren Kulturtechniken ist dies ähnlich gewesen. Die Freske ist auch kein Massenmedium mehr. Bestimmte Werkzeuge und Werkstoffe wurden und werden nur mehr hergestellt, weil Kunstrestauratoren sie brauchen, um die Fresken im Vatikan zu restaurieren. Aber nicht, weil eine zeitgenössische „Freskenindustrie“ diese Dinge bräuchte... Das ist also ein Pfad, der bestimmt wird durch den Wunsch, cultural heritage zu erhalten – und den braucht es beim Film auch, abseits der Medienindustrie. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Preise. Eine 16mm-Kopie eines Films von Bruce Baillie zu ziehen, wird in zehn Jahren um ein Vielfaches mehr kosten als noch vor zehn Jahren.
artechock: Wie schlägt sich das in den Kosten des Archivs und des Filmmuseum-Programms nieder?
Horwath: Vor allem die Kosten, die wir für eigene Restaurierungen haben, sind natürlich gestiegen. Es gibt nicht mehr viele Firmen, wo man z.B. hochwertige Ergebnisse auf 16mm bekommen kann. Das wird alles sukzessive teurer. Das ist der Prozess der Opern- oder Freskenwerdung des Films. In den Leihmieten schlägt sich das nicht nieder, da wir mit Partnern zu tun haben, die in einer ähnlichen Situation sind wie wir. Innerhalb der FIAF wird die gegenseitige Ausleihe fast durchwegs ohne Gebühren durchgeführt. Das betrifft noch nicht die Rechte, nur die Kopien. Dennoch zeigen sich auch Schwierigkeiten, beispielsweise eine Ozu-Retro zu machen, da hier die Rechtsabgeltungen immer teurer werden.
3. Nicht immer nur den Idealistentrupp spielen – Finanzierung und recognition in Österreich
artechock: Wie ist denn das Österreichische Filmmuseum finanziell aufgestellt, was ist der Republik das Haus wert?
Horwath: Hinter dem Filmmuseum steht ein Trägerverein, übrigens ebenso wie beim Filmarchiv Austria.
Beide Institutionen kommen aus der Gesellschaft von Interessierten, von engagierten Enthusiasten. Das Filmmuseum wurde 1964 gegründet, weil die Gründer dachten, es sei Bedarf da und die Tätigkeit des damals schon bestehenden Filmarchivs reiche nicht aus, um den Bedarf zu befriedigen.
Wann immer die öffentliche Hand überlegte, die beiden Archive zusammenzulegen, zeigte sich, dass das gar nicht so einfach ist, weil es sich eben um autonome Vereine handelt. Die öffentliche Hand könnte höchstens mit Subventionsentzug vorgehen. Stattdessen wählt sie wohl eher die Perspektive: Wunderbar, dass es zwei sind – da fällt es vielleicht nicht auf, wie wenig Subvention wir für diesen Bereich insgesamt geben…
Es ist ein eigentümlicher Zustand. Wenn man betrachtet, was man uns als Bundesbeitrag für die Jahrestätigkeit zuteilwerden lässt – 1,2 Millionen für das Filmarchiv und 600.000 Euro für das Filmmuseum – dann ist die Summe daraus im europäischen Vergleich nur ein Drittel bis Fünftel dessen, was vergleichbare Institutionen in vergleichbaren Ländern wie Schweiz, Belgien, Holland, Schweden oder Dänemark vom Staat erhalten. Einerseits hält sich also in Österreich die Anomalie, dass es zwei solcher Häuser gibt, während in allen vergleichbaren Ländern nur eines existiert, andererseits kommt die Republik seit vielen Jahrzehnten unglaublich günstig dazu, eine sehr hohe Reputation in diesem Bereich vorweisen zu können. Als Bemessungsgrundlage wären dabei gar nicht primär unsere schönen Besucherzahlen zu nennen, sondern vor allem qualitative Kriterien.
artechock: Was wären denn die Kriterien, an denen sich Institutionen wie das Filmmuseum messen lassen sollten?
Horwath: Häuser unserer Art sind kulturelle Infrastruktur und nicht daran zu messen, ob sie eine hohe Quote haben, obwohl das Filmmuseum auch aus dieser Sicht sehr gut dastünde. Aber darum geht es nicht. Als Kriterien der Bedeutsamkeit könnten wahrscheinlich gelten: die Akzeptanz und Beteiligung filminteressierter Kreise der lokalen Bevölkerung und derer, die an dem betreffenden Ort selber im Filmbereich tätig sind; weiters die Reflexion dessen, was ein Haus tut, durch die schreibende Fachwelt im In- und Ausland; dann auch die Frage, inwieweit so ein Haus das eigene Tun und die eigene Sammlung selber reflektiert und damit auch Fachdiskurse mitprägen kann; die Frage, welche Bandbreite und welche Formen der Beschäftigung mit den Sammlungen und mit Film im Allgemeinen angeboten werden; und sicher auch der Grad der internationalen recognition durch die Kollegenschaft im eigenen Metier – das wären für mich gewisse Markierungen, an denen ich die Bedeutung solcher Institutionen messen würde. Und insofern erlaube ich mir, zu sagen, dass die Republik Österreich froh sein muss, dass sie für so wenig Geld das Österreichische Filmmuseum bekommt.
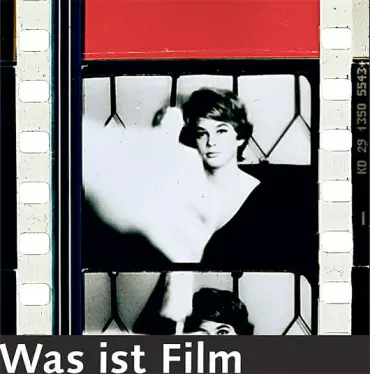
Wir arbeiten wirklich nicht unter luxuriösen Bedingungen. Aber ich bin mir bewusst, dass genau diese Situation bei gleichzeitiger Autonomie auch einen Vorteil darstellt, weil sie Beweglichkeit fast erzwingt, und weil sie auch zu einer hohen Identifikation und „Strebsamkeit“ im Team beiträgt. Die Autonomie ist die Voraussetzung dafür, dass das Haus bestimmte Positionen und Überzeugungen vertreten konnte und kann, die nicht auf Mainstreamtauglichkeit abgeklopft sind. Dass man ein bestimmtes Programm und eine bestimmte Sammlungs- und Vermittlungspolitik vertritt, die nicht vorher durch zig Gremien gehen mussten. Dass man im Zusammenspiel mit den interessierten Communities, die uns umgeben, auch Bestärkung erfährt und ein gewisses Selbstbewusstsein entwickelt. Dass das alles also nicht nur ein individuelles, subjektives Spiel ist, sondern dass sich rund um so ein Haus über Jahrzehnte eine bestimmte Kultur entwickeln kann, die nicht konventionell und austauschbar ist und trotzdem eine gewisse Verbindlichkeit ausstrahlt. Das kann so ein Haus jedenfalls besser als unmittelbar staatliche oder stärker bürokratisch verfasste Institutionen. Vielleicht ist das der Deal – geringe Mittel, aber Eigenständigkeit. Der kostet halt leider viel Energie und verlangt, dass man sich diesem Tun nahezu mit Haut und Haaren widmet.
Natürlich darf sich daraus keine Selbstlegitimation der Förderer ergeben, nach dem Motto, »das sind eh alles Idealisten«, weshalb der geringe öffentliche Beitrag schon in Ordnung sei. Man kann nicht immer nur den Idealistentrupp spielen. Es sind, verglichen mit den Ausgaben in anderen Kunstbereichen, wirklich läppische Summen.
Die Förderung des aktuellen Kinofilmschaffens wurde in Österreich in den letzten Jahren massiv erhöht, mitbedingt durch die großen künstlerischen Erfolge von Michael Haneke und anderen Filmemacher/innen – und diese Entwicklung finde ich natürlich äußerst positiv. Aber leider galt diese Verdopplung der Mittel nur für den Sektor Kinofilm, und nicht im Geringsten für die sonstige Filmkultur, für Institutionen wie uns oder Sixpack Film, für Filmforschung und Filmvermittlung, für Festivals, oder für das innovative, avantgardistische oder junge Filmschaffen, wo oft in kürzeren Formaten und äußerst vielfältig gearbeitet wird. Die öffentlichen Mittel für diesen anderen Sektor stagnieren seit etwa 15 Jahren, d.h. angesichts der Inflation: sie gehen zurück. Haneke und Ulrich Seidl wären die ersten, die zustimmen würden, dass die österreichische Filmkultur den Humus für die positive Entwicklung und Wahrnehmung des österreichischen Kinofilms mit all seinen Besonderheiten bildet. Es braucht ein diskursives Klima, die Möglichkeit zur Auseinandersetzung mit der Filmgeschichte und der Vielfalt filmischer Formen, es braucht die Lehre und die Möglichkeit, zu publizieren usw. Diese kulturelle Infrastruktur ist ein mitentscheidender Faktor für das Gedeihen oder Nichtgedeihen eines Filmlandes oder einer -region, einer Kinematographie. Daher ist es fatal – ganz abgesehen von unserem eigenen Budget –, wenn die Förderung so einseitig verteilt ist und die Schere zwischen den beiden Bereichen so extrem aufgeht.
artechock: Sie hatten vorhin erwähnt, dass Sie zur Zeit Ihrer Viennale-Leitung zusätzliche Mittel bei der Stadt bekommen konnten, die in die Retrospektive des Filmmuseums flossen. Gibt es immer noch die Möglichkeit, über die Viennale-Retrospektive die Mittel zu erhöhen?
Horwath: Nein. Das hat sich seitdem geändert. Die Stadt Wien gab dem Filmmuseum früher nur eine sehr geringe Jahresförderung und machte dann zusätzlich noch Geld für die Viennale-Retro frei. Als ich im Filmmuseum begann, war das ein äußerst prekärer Zeitpunkt: Die Albertina war eine Baustelle und hatte überdies Begehrlichkeiten gegenüber dem Filmmuseum, und die schwarz-blaue Bundesregierung hatte kein Interesse am autonomen Fortbestand des Filmmuseums; man hat sogar versucht, die Bestellung eines Nachfolgers zu verhindern. In dieser Situation ist es uns gelungen, die Stadt Wien als zweiten großen Finanzierungspartner für das Filmmuseum zu gewinnen. Das war damals die Rettung. Das Filmmuseum hatte 2001 ein Gesamtjahresbudget von circa 750.000 Euro. Jetzt sind es um die 2,1 Millionen. Der Bund und die Stadt sind jetzt auf ungefährer Augenhöhe die beiden Hauptförderer und decken jeweils etwa ein Drittel des Gesamtjahresbudgets ab. Das dritte Kuchenstück sind die Eigeneinnahmen, die Mitgliedschaften, Kinoeintritte, die Einnahmen durch Archivnutzung und Publikationen, Sponsoren und andere Drittmittel bei bestimmten Projekten.
4. Unterschiede und Spezifika – Zwei Archive in Wien
artechock: Noch eine abschließende Frage zur aktuellen Aufregung in den österreichischen Medien, die aufgrund der Eröffnung des sogenannten „Kinokulturhauses“ im Metro-Kino durch das Filmarchiv Austria eine neue Konkurrenzsituation des Hauses mit dem Österreichischen Filmmuseum suggeriert. Wie sieht es aus mit den Reibungspunkten zwischen den beiden Archiven?
Horwath: Es gab sicher in der Geschichte immer wieder konkurrenzhafte Momente, gerade dort, wo es um die öffentliche Mittelverteilung ging. Aber beide Häuser hatten von Beginn an komplementäre Schwerpunkte, und vor allem extrem verschiedene Zugänge zum Film. Sie waren, was die Persönlichkeiten wie auch die Positionen betrifft, nicht die besten Freunde, das weiß ich sowohl von Konlechner und Kubelka, als auch von Walter Fritz. Die Gründung dieses Hauses wurde seitens des Filmarchivs und in manchen Teilen der Kulturpolitik mit allen Mitteln der Bürokratie zu verhindern versucht. Später gab es aber auch Momente, wo die beiden Häuser richtiggehend „zusammengehalten“ haben, wenn es um Einflussnahmen von außen ging. Man hat auch, manchmal sehr mühevoll, gemeinsame Dinge realisiert wie den gemeinsamen Nitrofilmbunker Anfang der 70er Jahre und dessen zeitgenössische Variante vor einigen Jahren, oder das Projekt einer digitalen Filmrestaurierung, das vor etwa zehn Jahren begann.
Wichtiger als die jeweiligen Selbstdarstellungen, die nie vor berechtigtem oder unberechtigtem Eigenlob gefeit sind, sind wohl die Unterschiede und Spezifika, die aus Sicht der Kulturpolitik und der Öffentlichkeit erkennbar werden – nämlich, was die jeweilige kulturelle Mission und die Qualität ihrer Erfüllung betrifft. Dort, wo öffentliche Förderung vergeben wird, sollte klar sein, für welche Dinge eine Institution zuständig ist. Dazu braucht es aber auch Kenntnisse und Positionen seitens der Kulturpolitik, was man bei mehreren Ministern in der Vergangenheit eher vermisste.
Das „Kinokulturhaus“ des Filmarchiv Austria im Metrokino müssen sicherlich andere beurteilen als ich. Ich wundere mich nur ein bisschen, dass das als große Neuheit diskutiert wird. Das Filmarchiv hat dieses Kino 2002 übernommen und seither bespielt. Dann war drei Jahre Pause – Baustelle. Jetzt gibt es einen neuen, zweiten Kinosaal mit 49 Sitzplätzen und Galerieräumen, in denen künftig Ausstellungen stattfinden werden. What’s the big deal? Ändert das irgendetwas an der Art und Weise, wie – einerseits im Filmarchiv, andererseits im Filmmuseum – mit dem Medium Film umgegangen wird?
Ich glaube, dass Institutionen, meist über viele Generationen hinweg, einen bestimmten Geist vertreten, ein Grundverständnis bezüglich ihres Gegenstands. Das wirkt sich auf alle praktischen Aktivitäten aus, und es schreibt sich auch fort. In 40 oder 50 Jahren wachsen Strukturen und festigen sich Identitäten. Das hat nicht unmittelbar und schon gar nicht ausschließlich etwas mit den handelnden Personen zu tun, aber natürlich „suchen“ sich die Strukturen und Identitäten die entsprechenden Personen, die dann unter Umständen die prinzipiellen Unterschiede weiter verstärken. Jedenfalls ändert sich an solchen Unterschieden rein gar nichts, nur weil das eine Haus zusätzliche Räume erhält, das zweite Haus neue Sammlungen erwirbt und das dritte Haus neue Vermittlungsprogramme einführt.
Literatur:
- Fünfzig Jahre Österreichisches Filmmuseum, Hg. von Alexander Horwath unter Mitarbeit von Eszter Kondor, Synema – Gesellschaft für Film und Medien, Wien 2014
- Was ist Film – Peter Kubelkas Zyklisches Programm im Österreichischen Filmmuseum, Hg. von Stefan Grissemann, Alexander Horwath, Regina Schlagnitweit, Synema – Gesellschaft für Film und Medien, Wien 2010