In einer Zeit, in der man noch nicht gelebt hat |
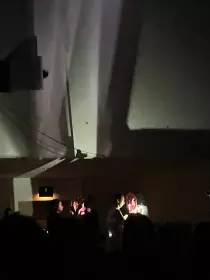 |
|
| Bildrausch der Projektoren | ||
| (Foto: Benedikt Guntentaler) | ||
Milena Gierke und die Subjektivität auf dem 5. exf f. – Tage des experimentellen Films Frankfurt
Unter den 61 Filmen, die auf dem diesjährigen »exf f. – tage des experimentellen films frankfurt« gezeigt wurden, stach ein Programm ob seiner extravaganten Struktur besonders hervor: »Frankfurter Formen: Milena Gierkes New York Filme«.
Weniger eine gewöhnliche Vorführung als eine Live-Performance stellt dieses zweigeteilte Programm dar, das über sich hinaus auf eines der großen Themen des Festivals verweist: Der subjektive Blick, die touristische Kamera, die ihre Darstellungsobjekte völlig für sich vereinnahmt, das objektiv Dokumentarische aufbricht für einen singulären, persönlichen Zugang zur Welt.
New York Film Diary
Im ersten, bestimmenden Teil dieses Programms wurde Gierkes Film-Tagebuch »New York Film Diary Sep. 3, 1994 – Oct. 3 1995« gezeigt. 96 Minuten, die ein ganzes Jahr umspannen, zeigen eine junge Künstlerin, die New York entdeckt, sich selbst emanzipiert, ihren Körper genauso erkundet wie diese fremde Stadt – alles mit der Kamera, alles durch einen nicht reproduzierbaren, einmaligen Blick. Gedreht wurde auf Super 8, geschnitten wurde der Film in der Kamera. Es gibt also keine nachträgliche Montage, die Länge und Abfolge der Aufnahmen wird noch während dem Filmen festgelegt, der Film selbst muss erst im Kopf entstehen, dann übertragen werden, festgehalten, verwirklicht. Keinen Ton gibt es, nur die analogen Bilder, die singulären Eindrücke einer Zeit, einer Stadt, die es so nicht mehr gibt.
An diese performative Subjektivität knüpft das Konzept der Vorführung des Films an: Ursprünglich zeigte Gierke ihre Filme stets selbst, legte die Rollen (vier Stück sind es, es gibt also unregelmäßige Pausen im Film, Unterbrechungen) eigens in den Projektor, war ausführende Künstlerin im Sinne des Schauens, Filmens, Zeigens.
Diesmal ist es anders: Gierke ist erneut anwesend, gibt eine kurze Einführung, überlässt die Projektion aber einem jungen Mann aus dem Team. Sie sei sick, krank, selbst kann sie nicht mehr vorführen. Es ist tragisch, natürlich, doch gewissermaßen verstärkt diese Begebenheit die Wirkung des Films, der Performance. Gut gelaunt, ein wenig zurückgenommen, aber zweifellos glücklich über die Vorstellung steht und sitzt Gierke neben dem Projektor, gibt während den Rollenwechseln kurze Hinweise, lobt den Vorführer, erklärt die Schwierigkeiten einer Super-8-Projektion.
Ein eigentümliches Gefühl entsteht, eine Liveness, die den Film beständig transformiert, herauslöst aus seinen ursprünglichen Betrachtungen, diese zwar konserviert, aber doch immer neu denkt, untrennbar mit unserer Gegenwart verknüpft. Was wir sehen, ist gewissermaßen eine »Zeitkapsel«, das Erforschen einer Stadt, das Sich-Erkennen in dieser Stadt, durch diese Stadt, durch das Filmen dieser Stadt. Bewusst unsicher wirkt dieser Film, mal gibt es Spielereien (eine schnell aufeinander folgende Montage von Wassertanks, Aquarien, die minutenlang gefilmt werden), immer wieder schleicht sich aber Gierkes Privatleben in den Film, so unmittelbar, dass jede Symbolik verschwindet. Szenen mit ihrem (man muss mutmaßen) Liebespartner, Wochenendausflüge, Essen mit Freunden. Und, noch direkter: Die umgedrehte Kamera, die von New York wegführt, hin zu Gierke selbst, die ihr Gesicht filmt, mal glücklich, mal als hätte sie Sekunden davor geweint. Oft schwebt der Blick über ihren Körper, dann, wenn sie nackt im Bett liegt. Nie ausgestellt wirken diese Momente, selten kommt ihnen ein dramaturgischer Nutzen zu. Sie reflektieren rein auf sich selbst, sind ein schüchternes, vorsichtiges Befragen des eigenen Körpers, des eigenen Zustands zu einem präzise festgehaltenen Augenblick.
So rauscht dieser wundervolle Film förmlich durch, nur wenige Sequenzen scheinen wirklich zusammenzugehören, eine definitive Stimmung zu entfalten. Der Rest ist ein unaufhörliches Experiment, eine skizzenhafte Reflexion über diesen Abschnitt im Leben.
Mit Gierke im Raum wiederholt sich die damalige Unsicherheit, führt weg von der Künstlerin hin zum Publikum. Eine Verkettung verschiedener Momente der Zeitlichkeit entsteht: Zunächst natürlich der Film, 1994 in NYC, dann Milena Gierke selbst, die zurückblickt, gleichzeitig völlig in der Gegenwart steht, den Film schließlich präsentiert. Dann der Vorführer, ein Stellvertreter, der immer wieder (man hört es ganz deutlich) auf den Projektor sprayt, die Rollen wechselt, die selbst natürlich eine eigene Zeitlichkeit besitzen, zufällige Abnutzungen aufweisen, die ganzen Jahre selbst erlebt haben. Und dann natürlich – wie immer, bei jeder Vorstellung – das Publikum, das seine eigene Historie, die eigenen Erlebnisse auf den Film projiziert, ihn überlagert mit der eigenen Geschichte.
Durchaus melancholisch drückt sich dieses Zusammenspiel aus, seltsam gliedert es das eigene Leben. Die Augenblicklichkeit und eben Subjektivität dieses wirklich persönlichen Films rückt immer mehr in den Hintergrund, wird Schablone für eigene Reflexionen.
Hat sich Gierke vor 30 Jahren mit diesem Film noch selbst befragt, besitzt er nun längst ein Eigenleben, hat sich gewissermaßen gelöst von der unbedingten Beziehung zu seiner Regisseurin. Und doch muss sie da sein, im Raum, um diese Trennung zu verstärken, um »New York Film Diary Sep. 3, 1994 – Oct. 3 1995« zu antiquieren und zu erneuern. Mit jeder Vorstellung wird er anders wirken, wird der Zugang ein neuer sein, jedes mal performt er sich selbst, performt Gierke ihn durch ihre bloße Präsenz, verändert sich die anfangs so undurchdringbar wirkende Subjektivität, wird zu eigenen Erinnerungen, eigenen Unsicherheiten, die natürlich nie an jene Gierkes heranreichen. Der eigene Traum wird ein anderer, das eigene New York ein fremdes, transformiert lediglich, weil sich eine Kamera vor das Auge geschoben hat, Gedanken und Blicke festhält, die sich nicht wiederholen lassen, die immer neu wirken, trotz des Alters, trotz des anderen Vorführers. Das Persönliche weicht einem kollektiven Raum des Denkens, und doch ist jeder darin allein, sieht etwas anderes, sieht nicht einmal das, was diese Kamera vor Jahren festhielt. Was für eine schöne Vorstellung, das eigene Leben wiederholen zu können, in stummen Bildern, die man selbst noch nie gesehen hat, aufgenommen in einer Stadt, in der man noch nie war, gedreht in einer Zeit, in der man noch nicht gelebt hat.
- Website des exf f. – Tage des experimentellen Films Frankfurt
- exf f. 2025 : Wenn wir Film sehenEin Besuch des 5. exff im Frankfurter Uni-Kino Pupille (11.09.2025)
- exf f. 2025 : Peter Hutton bei den Tagen des experimentellen Films Frankfurt (11.09.2025)