Cinema Moralia – Folge 178
Frischer Wind aus dem Süden |
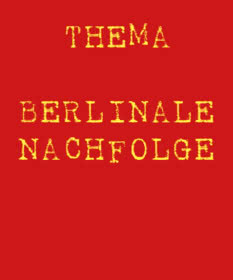 |
|
| Morgen wird es offiziell… | ||
Doppelspitze in Berlin: Carlo Chatrian wird der neue künstlerische Leiter der Berlinale – der Beginn eines überfälligen Umbruchs – Cinema Moralia, Tagebuch eines Kinogehers, 178. Folge
»Bei einer solch bedeutenden Personalscheidung braucht man Sachkunde. Wenn man die nicht aus eigener Anschauung hat, muss man sie sich holen. Und man braucht Empathie, man sollte ein Gefühl haben für die Häuser, ihre Tradition und die Stimmung in deren Mitarbeiterschaft, wenn man sich auf die Suche nach einer neuen Leitung macht. An alledem hat es in diesem Fall gefehlt. Deshalb ist es schiefgegangen.«
Monika Grütters, Kulturstaatsministerin, am 19.04.18 über die Intendantenbesetzung an der Berliner Volksbühne
+ + +
Plötzlich ging alles ganz schnell. Nach einer über ein Jahr andauernden Hängepartie, mit diversen verstrichenen offiziellen wie inoffiziellen Fristen, und nach Gesprächen mit über 40 Kandidaten lud das Kulturministerium (BKM) am Dienstag Mittag zu einer Pressekonferenz: Am kommenden Freitag werde bekanntgegeben, wer im nächsten Frühjahr die Nachfolge des scheidenden, im 18. Jahr amtierenden Berlinale-Chefs Dieter Kosslick antreten wird. Doch bereits am gleichen Abend meldete die Berliner »BZ« einen Namen, und im Minutentakt zog die Konkurrenz nach, bald auch die internationale Fachpresse. An diesem Mittwoch bestätigten es dann auf Nachfrage jene »informierten Kreise«, die sich nicht offiziell zitieren lassen, auf deren Auskunft aber Verlass ist: Der 46-jährige Italiener Carlo Chatrian, seit 2012 Leiter der Filmfestspiele von Locarno, wird der neue künstlerische Leiter der Berlinale. Chatrian wird damit der wichtigere Teil einer Doppelspitze, auf die die vielfältigen Aufgaben Dieter Kosslicks in Zukunft aufgeteilt werden. Den kaufmännischen Teil der Direktion soll eine Frau übernehmen, deren Name am Freitag bekanntgegeben wird. Dem Vernehmen nach handelt es sich um niemanden, deren Name in den letzten Monaten gehandelt wurde, sondern um »eine Überraschung«.
+ + +
Die Entscheidung für eine Doppelspitze ist überzeugend: Die Zeiten der großen Zampanos und ihrer One-Man-Shows à la Kosslick sind schon lange vorbei – kein großes A-Filmfestival außer Berlin wird heute von nur einer Person geführt – schon weil kein Mensch gleichzeitig einen derart großen, weitverzweigten Apparat wie die Berlinale kontrollieren, gleichzeitig über 1000 Filme sichten und überdies noch Kontakte zu den Filmszenen der ganzen Welt pflegen kann.
Eine
Aufteilung in die kuratorische Programm-Verantwortung und in die kaufmännische Geschäftsführung ist daher einleuchtend.
+ + +
Auch die Entscheidung für die Person Chatrian ist spannend und gut. Mit dem Italiener hat nun auch die Berlinale endlich das, was alle anderen großen europäischen Festivals schon lange haben – einen echten Cinephilen an der Spitze, einen Direktor, der als Filmwissenschaftler ausgebildet wurde, und der als Autor und Filmhistoriker gearbeitet hat.
Unter den großen Festivals der Welt ist Locarno der Berlinale am ähnlichsten. Mit 300 Filmen gibt es auch hier ein bisschen zu
viele Filme und Sektionen – unabhängig davon, dass eine Verschlankung dringend wünschenswert ist, hat Chatrian schon bewiesen, dass er den Spagat eines solchen Riesenfestivals zwischen zarter Filmkunst und grobem Mainstream spielend bewältigt. Denn die »Piazza Grande« von Locarno, das größte Freiluftkino Europas, ist mit ihren bis zu 8.000 Sitzplätzen viermal so groß wie das größte Berlinale-Kino. Solch ein Ort will erstmal gefüllt werden.
Mit Locarno hat Berlin schon früher
gute Erfahrungen gemacht: Der beste und erfolgreichste Direktor der Berlinale-Geschichte, der Schweizer Moritz de Hadeln (Leiter von 1980-2001) war zuvor ebenfalls Direktor von Locarno.
+ + +
Nun ist Berlin bekanntlich ein sehr spezielles, schwieriges Pflaster, und gerade kulturpolitisch vermintes Terrain – man denke nur an die jüngsten Pleiten um Volksbühnen-Chef Chris Dercon, die diversen Probleme bei der inhaltlichen Gestaltung des sündteuren Humboldtforum und die schwierige Nachfolge der Filmschule DFFB.
Doch auch davor dürfte dem aus dem norditalienischen Turin stammenden Chatrian nicht bange werden. »Wer mit der Tessiner Tourismus-Mafia
zurechtkommt«, so ein langjähriger Beobachter, »wird auch im Berliner Kultursumpf nicht untergehen.«
+ + +
Im Gegenteil könnte es für Chatrian zum Vorteil werden, dass er von außen kommt. Denn in der deutschen Filmszene hat er keine Feinde, aber auch keine falschen Freunde, denen er irgendetwas schuldig ist, oder sich verpflichtet fühlen muss. Das gleiche gilt auch für die Berlinale selbst, wo die unter Kosslick knapp zwei Jahrzehnte lang fröhlich erstarrten Strukturen dringend frischen Wind brauchen, und auch Chatrian nicht darum herumkommen wird, unbequeme Entscheidungen zu treffen –
sprich erstarrte Strukturen umzukrempeln, liebgewordene Schrebergärtchen einzuebnen und Personen auszutauschen.
Am schwierigsten dürfte es für Chatrian werden, die provinzielle, notorisch fremdenskeptische und hochverfilzte Berliner Medienlandschaft auf seine Seite zu bringen. Viele Hauptstadtblätter sind Kosslick seit Jahren in inniger Medienpartnerschaft verbunden, und tun sich schwer mit einer unabhängigen – und das heißt manchmal auch kritischen
– Berichterstattung über die Berlinale. Alles was anders sein wird, als unter dem geliebten Show-Man mit dem Roten Schal dürfte dort erstmal misstrauisch beäugt werden.
Um so mehr darf man Chatrian eine faire Chance wünschen.
+ + +
Dass er sie erhält, das ist allerdings auch dringend nötig. Es wäre viel zu einfach, würde man glauben, die Probleme der Berlinale wären nur Personalfragen. Ganz im Gegenteil müssen sich bei der Berlinale die Struktur ändern, die Art der Programmierung, die Kriterien der Filmauswahl, die ganze Haltung und Auffassung, die das Festival von sich selber hat, wie es wahrgenommen werden will. Zusammengefasst: Die Berlinale braucht mehr Schärfe. Mehr Kontur. Mehr Mut, sich von anderen
Festivals, A-Festivals zu unterscheiden – aber zugleich mehr Mut, mit ihnen in Wettbewerb zu treten. Kosslicks Lieblingswort »Publikumsfestival« ist längst zur Floskel geworden, mit der jede Frage vermeintlich beantwortet wird.
Dazu hat man an dieser Stelle schon vieles lesen können und wird das auch in Zukunft tun.
+ + +
Aber der Satz, der gar nicht so selten an gewissen Berlinern Filmstammtischen fällt – »bei der Berlinale müssen Köpfe rollen« – der stimmt irgendwie eben auch. Man muss solche martialischen Worte nicht mögen, aber klar ist: Sachfragen sind von Personalfragen nicht eindeutig zu trennen. Der Berlinale-Fisch stinkt zwar vom Kopf her, aber Fäulnis ist an vielen Stellen erkennbar. Denn zum Regiment Kosslicks gehören die Spuren, die er in den Köpfen seiner Mitarbeiter und der Öffentlichkeit hinterlässt – eine grundsätzliche Praxis, mit Filmen und Filmemachern und Gästen und Medienvertretern und nicht zuletzt mit dem Publikum umzugehen, die ungut ist. Die keinen Spaß macht. Die nicht sympathisch ist.
+ + +
Interessant ist es allerdings gerade zu beobachten, dass jenes Köpferollen in vielen Fällen offenbar gar nicht nötig sein wird, da sich die betreffenden Personen (um mal im Bild zu bleiben) im Augenblick schon selbst entleiben. Über den Ausstieg des Forumsleiters Christoph Terhechte hatten wir bereits berichtet. Im kommenden Jahr wird das Forum von einer Dreierspitze geleitet, die vielversprechend besetzt ist: Der Arsenal-Vorstand, namentlich Stefanie Schulte Strathaus (Leiterin des Forum Expanded), Milena Gregor und Birgit Kohler, die schon seit Jahrzehnten auch im Forum mitarbeiten, übernehmen ab dem 1. Juli die Leitungsaufgaben für das Forum 2019. Warum sollte diese Konstellation nicht auch über das kommende Jahr hinaus Bestand haben?
+ + +
Dies schreibe ich im Wissen, dass eine andere vielversprechende Dreierkombination bereits wieder zerbrochen ist: Im Panorama wurde im Vorjahr ebenfalls ein Trio zum Nachfolger des ebenfalls auf eigenen Wunsch zurückgetretenen langjährigen Leiters Wieland Speck benannt: Paz Lázaro als Leiterin, der frühere Assistent von Speck, Michael Stütz, und der ehemalige Programmberater Andreas Struck wurden neben Lázaro als Kuratoren benannt. Mit dieser auch strukturellen Erneuerung
ist es nach einem Jahr offenbar bereits wieder vorbei – aus Berlinale-Kreisen war jedenfalls zu hören, das Trio habe sich zerstritten und Lázaro sei jetzt alleinige Leiterin. Wie gewohnt war bei der Berlinale dazu keine offizielle Stellungnahme zu bekommen.
Gerade auf Lázaros Zukunft bei der Berlinale darf man gespannt sein. Sie kam mit Kosslicks Amtsantritt zum Panorama, und war über zehn Jahre als Programm-Managerin der Sektion in der wichtigsten Schaltstelle, aber auch gut
gedeckt im Hintergrund. Das wird nunmehr nicht mehr möglich sein, was für die sehr zurückhaltend, geradezu öffentlichkeitsscheu auftretende Lázaro fraglos eine große Umstellung bedeuten wird.
+ + +
Entscheidend für die kommende Führung der Berlinale wird aber etwas anderes: Wenn am Freitag auch eine kaufmännische Direktorin berufen wird, haben wir erstmal zwei Berlinale-Chefs. Wie werden Chef A und Chefin B zusammenarbeiten? In den Presseberichten dieser Tage ist gelegentlich zu lesen, es werde die von Grütters gewünschte Doppelspitze wohl doch nur in einer abgeschwächten Form geben. Aber das sind Spekulationen – von besser informierter Seite hört man, da sei nichts dran. Die »deutschsprachige« Frau sei keine derer, »deren Name im Umlauf ist, oder die sich selbst ins Gespräch gebracht haben«.
Die wichtigste Frage für die Zukunft der Berlinale ist daher, wer welche Entscheidungsbefugnisse bekommt, und wie die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Bereichen laufen soll. Klarerweise kann man Zuständigkeiten aufteilen. Aber ebenso klar ist, dass es bestimmte Fragen gibt, die solche Zuständigkeitsgrenzen überschreiten. Zwei Beispiele: Wenn der künstlerische Leiter eine Sektion streichen will, oder eine andere neu schaffen – darf er dann darüber entscheiden? Denn die Entscheidung kostet Geld, könnte Einnahmen reduzieren, oder Ausgaben erfordern.
Oder: Wenn einer der beiden Direktoren aus bestimmten Gründen den Termin der Berlinale verlegen will, betrifft das das komplette Festival? Wer entscheidet solche Fragen, falls sich die beiden Chefs nicht sowieso einig sind? Die Kulturstaatsministerin?
Vom Filmfestival Locarno kann man jedenfalls lernen, dass man Kompetenzen auch nicht auf zu vielen Schultern verteilen sollte. Nur eine Handvoll Menschen ist dort beispielsweise für die Filmauswahl zuständig – also für fast
genauso viel Filme, die in Berlin von ganzen Auswahlkommissions-Kohorten ausgewählt werden.
+ + +
Anderes Thema. Dem Filmemacher Wim Wenders scheint in den letzten Jahren in vieler Hinsicht die Gelassenheit abhanden gekommen zu sein. Denn in den Interviews zu seinem neuen Film entpuppt sich Wenders, zumindest früher ein Darling der deutschen Filmkritik, jetzt als Verächter unabhängiger Kritik.
Zum Beispiel diese Passage: »Wenn Sie sich meine Dokumentarfilme angucken, handeln die alle von Menschen, die ich mag und deren Kunst oder Arbeit ich so schätze, dass ich meine Freude
oder Begeisterung daran teilen will.Ich bin keiner, der etwas infrage stellen will. Das finde ich ziemlich unproduktiv. Heute ist das leider das Hauptgeschäft, vor allem von investigativem Journalismus und letzten Endes auch viel zu oft der Kritik.Als junger Mann habe ich mein Studium unter anderem mit Filmkritiken verdient. Dabei habe ich fast ausschließlich über Filme geschrieben, die ich mochte. Ich fand es eine Zeitverschwendung, über Filme zu schreiben, die ich nicht
mochte.«
Was für blöde Aussagen, was für ein erbärmliches Verhältnis zur Kritik! Und wie verlogen. Denn natürlich hat Wenders auch Filme verrissen, wie man leicht nachlesen kann.
+ + +
Siegfried Kracauer Preis. Auch in diesem Jahr schreibt der »Verband der deutschen Filmkritik« (VDFK) gemeinsam mit den Filmförderungen von NRW und Baden-Württemberg wieder den mit insgesamt 15.000 Euro dotierten »Siegfried Kracauer Preis« für Filmkritik aus – und erinnert damit an den international wohl wichtigsten deutschen Filmkritiker, Filmhistoriker und Filmtheoretiker Siegfried Kracauer.
Bewerbungsschluss ist der 1. September 2018, genaue Informationen
gibt es unter der Internetseite www.siegfried-kracauer-preis.de.
+ + +
Der Extremismus-Tourist Markus Söder, hauptberuflich Wahlkämpfer, im Nebenberuf Bayerischer Ministerpräsident, ist offenbar unausgefüllt. So unternimmt er nun eine Ausweitung der Wahlkampfzone in die Filmpolitik, die er Medienpolitik nennt. Am Freitag gibt es eine Pressekonferenz im Gasteig, bei der Söder höchstpersönlich, flankiert von der Leiterin des Filmfests München Diana Iljine und dem stv. Aufsichtsratsvorsitzenden des Filmfests, Medienminister
Georg Eisenreich, »über die geplante Weiterentwicklung des Münchner Filmfests zu einem Medienfestival« informieren will. Ziel der Weiterentwicklung sei es, »das Münchner Filmfest für Festivalbesucher noch attraktiver zu gestalten und so den Medienstandort Bayern insgesamt zu stärken«.
Diese Formulierungen lassen in ihrer Vagheit erstmal nichts Gutes ahnen. Statt einfach mehr Geld zu geben, soll aus dem Filmfest womöglich die neueste Spielwiese für die obergärige
Landespolitik werden.
Und der Begriff »Medienfestival« lässt darauf schließen, dass die Bedeutung des Kinos und des Films beim Filmfest eher marginalisiert werden soll – dabei könnte man gerade von Medienwissenschaftlern lernen, dass es Medien gar nicht gibt.
(to be continued)
- Flüchtige Filme, flüchtige Gedanken
Film und Philosophie treffen sich an der Volksbühne – Cinema Moralia, Tagebuch eines Kinogängers 177. Folge – von Rüdiger Suchsland - Cinema Moralia – Rüdiger Suchslands Tagebuch eines Kinogehers. Since 2007!