Die Vielfalt des Dokumentarischen und die Rolle des Festivals |
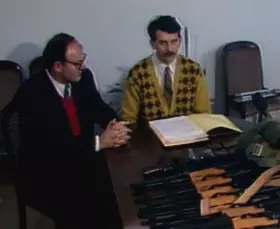 |
|
| Atmosphäre der Angst: Peacemaker von Ivan Ramljak, Gewinner der Goldenen Taube | ||
| (Foto: DOK Leipzig · Ivan Ramljak) | ||
Ein Film aus Berlin und ein kroatischer Film gewinnen, die neue Chefin stellt sich vor und die Verantwortung der öffentlich-rechtlichen Sender wird eingefordert – eine Bilanz des diesjährigen DOK Leipzig
Die Schauspielerin Bulle Ogier wirkte in rund 50 Jahren an beinahe 100 Filmen mit. Eugénie Grandval hat ihr nun ein Portrait gewidmet, das auch die dringend nötige Erinnerung an all das bietet, was das Kino grundsätzlich sein kann, und leider gerade oft nicht mehr ist.
Ein »typisch französischer« Film, der keine Angst hat vor Anspruch und Intelligenz. Und ein Film, der Archivmaterial zu einer neuen Erzählung montiert.
Ein Film aus Frankreich und ein Highlight aus dem Programm des diesjährigen DOK Leipzig, dem wichtigsten Dokumentarfilmfestival Deutschlands, und eines der besten Dokumentarfilmfestivals der Welt.
Am Sonntagabend ging das Programm nach einer Woche zu Ende. Bereits am Samstag wurden die 17 Preise durch nicht weniger als 12 Jurys vergeben. Überhaupt kennzeichnet ein Überfluss an Sektionen (16) und Filmen (252) dieses Festival, dem etwas mehr Klarheit und Beschränkung auf Wesentliches guttäte.
+ + +
Die Auswahl ist insgesamt sehr überzeugend. Das belegte auch ein Statement der Jury »Deutscher Wettbewerb« anlässlich der Preisverleihung, das man eindeutig auch vor dem Hintergrund anderer Dokumentarfilmfestivals in München und diese Woche in Duisburg verstehen muss.
Dort dominiert das Fernsehen, in Leipzig ist es anders, finden Ines Weizman, Maike Mia Höhne und Gerd Kroske:
»Wir freuen uns, dass die öffentlich-rechtlichen Sender als Preisstifter das Festival begleiten, dass wir vor jedem Screening lesen durften, dass in den Mediatheken von 3Sat, MDR und ARTE die dokumentarische Form ihren Platz hat. Das ist super.
Im deutschen Wettbewerb, in dem wir lange wie kurze Filme gesichtet haben, ist kein Film in der Auswahl gewesen, der mit
öffentlich-rechtlichen Mitteln oder auch mit den Mitteln aus der Filmförderung finanziert worden ist. Das hinterlässt uns mit Fragen zur Verantwortung der Öffentlich-Rechtlichen Sender und zu den Förderungen.
Wenn Filmschaffende ihre Filme mit sehr sehr sehr begrenzten finanziellen Mitteln herstellen, ist der Grad der Selbstausbeutung Teil einer deutschen, meist romantisch verklärten, Lesart – muss das so sein?
Wie oft kann das so sein?
Wie oft kann die
Selbstausbeutung für die Produktion eines Films möglich sein und warum?
Warum ist es so schwer, komplexe Filme, die von einer engagierten, ausgebildeten Generation gedacht und produziert werden, finanziell zu unterstützen, dramaturgisch mit einem sehr offenen Blick und Haltung zu begleiten und so, auch im Fernsehen Raum zu schaffen, für Filme, die anspruchsvoll kommunizieren.
Der Beweis, dass ein Publikum diese Filme will, ist bei DOK Leipzig überdeutlich in den
Publikumszahlen zu sehen. Und ebenso bei den vielen Festivals bundesweit. Der Eröffnungsfilm des DOk Leipzig, wäre aktuell in Deutschland nicht möglich gewesen zu produzieren:
Unmöglich. Wie schade!«
+ + +
Es gibt zwar nicht alles im Programm beim DOK Leipzig, aber es gibt sehr sehr viel. Es gibt Filme über so ziemlich jeden Teil der Welt, darunter in diesem Jahr gleich zwei Retrospektiven über US-amerikanisches Kino und eine eigene Sektion über Kino aus »Mittel- und Osteuropa«.
Es gibt einen Wettbewerb für die internationalen Filme und einen für die deutschen – in beiden laufen übrigens kurze Filme von wenigen Minuten genauso wie Filme, die über zwei Stunden dauern. Denn
den Kurzfilmwettbewerb hatte Christoph Terhechte, der jetzt nach sechs Festivalausgaben auf eigenen Wunsch abtretende künstlerische Leiter und Festivaldirektor des DOK Leipzig, zu seinem Amtsantritt abgeschafft.
Die besten und interessantesten Filme laufen, das sagt die Erfahrung, aber sehr oft auch außerhalb dieser Wettbewerbe, weil man dort in zwei Sektionen die gewissermaßen mutigsten und vielfältigsten Filme sehen kann.
Etwa im Programm »Camera Lucida«, das sich, wie es im Katalog heißt, der »kaum sagbaren und gerade deshalb bestechenden Wirkung eines Bildes« widmet, die Dokumentarfilme zeigt, »die Kinokonvention und Realität auf besonders luzide Weise herausfordern.«
Diese Beschreibung ist absolut zutreffend – und wirft doch gerade deshalb die Frage auf, warum diese tollen Filme nicht gleich im Wettbewerb zu sehen sind.
+ + +
Und hier kommen wir zu dem, was man »die Probleme« von DOK Leipzig nennen kann, nicht erst in diesem Jahr, sondern schon seit einiger Zeit, auch vor Christoph Terhechtes Amtsantritt.
Terhechte, der nun nach sechs Jahren seinen Abschied nimmt, hat, das muss man zunächst betonen, DOK Leipzig stark verbessert und weiterentwickelt.
Nachdem das Festival durch eine desaströs missglückte Leitungsperiode unter der Finnin Lena Pasaanen am Boden lag, hat er es durch die Pandemie geführt und wieder klar als das beste deutsche und eines der besten weltweiten Dokumentarfilmevents auf der internationalen Festivallandkarte platziert.
Dies gelang allerdings dadurch, dass er ein paar sehr bestimmte Entscheidungen getroffen hat, über die von Anfang an das Fachpublikum geteilter Meinung gewesen ist und die auf lange Sicht das Festival auch ein bisschen einschränken: Dass im Wettbewerb Filme aller Längen miteinander um die Preise wetteifern, schadet der Sichtbarkeit der Kurzfilme. Und es ignoriert, dass Kurzfilme bis zu einer bestimmten Länge eine Art eigenes Genre sind, und dass man einen zwölf-minütigen Film nur sehr schlecht, also mit Verlusten, mit einem zweieinhalbstündigen vergleichen kann.
+ + +
Weil Terhechte sich geschmacklich stärker für das Kino des Westens interessiert, ist das Alleinstellungsmerkmal des einst wichtigsten Festivals der DDR, der Blick nach Osten, in den letzten Jahren vernachlässigt worden – und es ist bezeichnend, dass es einerseits eine eigene Sektion für Filme aus Osteuropa gibt, auf der anderen Seite im Wettbewerb selbst unter insgesamt 20 Filmen nur zwei Filme aus Ex-Jugoslawien, aber gleich sechs aus Nordamerika.
Solche
Ungleichgewichte dürfte die neue Leiterin Ola Staszel mit einer – vermutlich auch finanziell nötigen – Straffung des Programms ausgleichen.
Noch wichtiger aber wäre es, die stilistischen Verengungen der Auswahl zu korrigieren: In den letzten sechs Jahren, bedingt nicht nur durch den Direktor Terhechte, sondern auch durch manche Mitglieder der Auswahlkommission, gab es ein Übergewicht an Filmen mit privatistischen Themen und Zugängen. Stilistisch dominierten Artcore und Slow-Cinema, die die Kunstblase bedienen, im regulären Kinobetrieb aber kaum eine Chance haben.
Aber Dokumentarfilm ist so viel mehr: Archiv-, Montage- und Found-Footage-Filme konnte man in den letzten Jahren in Leipzig an einer Hand abzählen.
Es gab auch kaum engagiertes, politisches Kino und Agitprop, zu wenig über extremistische Bedrohungen, Kriege und Gesellschaftspolitik.
Und auch kaum Reportagefilme – es ist aber auch Aufgabe eines Filmfestivals, diese Seiten des Mediums abzubilden.
Insgesamt zu wenig Intellektualität und etwas zu viel Gefühl
und Befindlichkeit, also.
+ + +
Die neue Leiterin Ola Staszel ist auch vor diesem Hintergrund eine interessante, gute Wahl. Staszel ist derzeit die Leiterin des deutsch-polnisch-tschechischen Neiße-Filmfestivals im Dreiländereck und zeichnet dort für die Bereiche Dokumentar-, Spielfilm und Geschäftsführung verantwortlich. Sie studierte Film- und Literaturwissenschaft sowie Europastudien an den Universitäten Wrocław und Aachen. Seit 1999 lebt sie in Berlin. Staszel gründete und leitete auch das Festival des mobilen Kinos »The Rolling Movies«.
Bei einem gemeinsamen öffentlichen Gespräch zwischen Terhechte und Staszel wurden auch bei aller offenkundigen gegenseitigen Wertschätzung und Sympathie gewisse Akzentverschiebungen erkennbar.
Staszel wirkt wie eine gute Zuhörerin. Ihre Liebe zu Osteuropa dürfte dem ursprünglichen Alleinstellungsmerkmal von DOK Leipzig wieder mehr Raum geben. Vielleicht dürfen in der Auswahlkommission in Zukunft auch wieder etwas mehr diverse Perspektiven und weniger Konformität dominieren.
+ + +
Zugleich waren nach einer knappen Festivalwoche klare Trends und »rote Fäden« im Programm erkennbar. So ist das Anthropozän, das Zeitalter der durch den Menschen (um-)gestalteten Natur, endgültig im Kino angekommen.
Ein Teil davon ist der Klimawandel und ein verändertes Verhältnis vieler Menschen zur Erde. Prägnant zeigte sich das in dem französischen Film Il est temps d’atterrir von Raphaël Girardot und Vincent Gaullier, der den internationalen Titel Time to Land trägt, also: »Zeit, sich zu vererden«, oder mit den Worten des Philosophen Bruno Latour (1947-2022) formuliert: »terrestrisch zu werden«. Latour spielt eine zentrale Rolle in diesem Film und stand den Regisseuren auch für mehrere Online-Gespräche zur Verfügung. Dabei zeigt er sich zunehmend gezeichnet von seiner Krebserkrankung, zugleich aber als präziser Analyst mit Verve, Humor und klaren Statements.
In seinem Buch »Kampf um Gaia« behauptet Latour die Heraufkunft eines »neuen Klimaregimes«, wie er es versteht, einer umfassenden Transformation von Natur-, Wissenschafts-, Politik- und Gesellschaftsverhältnissen. Die Natur tritt nicht länger als Objekt auf, sondern wird zum Akteur.
Mit solchen Ideen wurde Latour zum international bekannten Kämpfer für das Verschieben von Paradigmen, verbunden mit dem Ziel, das menschliche Individuum möge seinen eigenen »Platz im Kreislauf der Natur« neu definieren. Der Philosoph prägte dafür den Begriff einer »ökologischen Klasse«, die es auf dem Planeten Erde zu erschaffen gilt, um sich grundlegender Optionen für das Handeln in Krisen bewusst zu werden.
+ + +
Die Filmemacher Raphaël Girardot und Vincent Gaullier versuchen in ihrem Film, die oft abstrakten und metaphorisch formulierten Thesen Latours möglichst konkret in der Erfahrungswelt zu verankern, und stellen die Frage, wie wir dort, fern von Wissenschaft und Universität, auf Latours Fragen, Visionen und Konzepte reagieren? Regen sie Debatten an, wenn wir ihnen begegnen? Erreichen sie uns?
Dazu treffen sie in Frankreich, Belgien und im Senegal Menschen, die Latour beim Wort nehmen, und beim Beobachten, Beschreiben und Handeln eigene neue Wege beschreiten wollen oder es in neuen Gemeinschaften bereits tun – auf Äckern und in Wäldern, beim Fischen und Demonstrieren, als Autonome und in gängigen Strukturen. Einige davon konfrontieren die Regisseure mit Latours Schriften, stoßen Gedanken und Gespräche an und lassen Bruno Latour selbst mit kurzen Statements wiederum darauf reagieren.
Deutlich wird an manchen Stellen des Films die grundsätzliche Gefahr, den Menschen und sein Leben gegenüber der Natur auch moralisch und in seinem »Wert« zu relativieren, und ihm gegenüber im »Kreislauf der Natur« (so Latours Lieblingsformel. Aber gibt es den überhaupt? Und wer läuft hier eigentlich mit wem nach welchen Gesetzen?) nur einen marginalen Platz geben wollen.
+ + +
Bei aller Vorsicht gegenüber manchen gewagten und »steilen« Thesen des Franzosen gab es in Leipzig einige Filme, die dem Publikum eine Ahnung davon gaben, was das »neue Klimaregime« in der Praxis bedeutet: Der kanadische Film The Inheritors (Regie: Serge-Olivier Rondeau) schildert das Leben der Möwen. Riesige Kolonien dieser Tiere, genau gesagt der »Ringschnabelmöwen«, hausen nahe Montreal. Der Film zeigt diesen riesigen kreischenden Haufen, der keinen Menschen braucht, und außer durch die Kamera auch ungestört ist. Doch der Schein des Friedens trügt. Denn die Möwen jagen, töten und fressen sich gegenseitig, obwohl genug Futter da ist, die Stärksten kommen durch und wir Zuschauer erfahren am Schluss, dass diese offenkundig sozialdarwinistisch verfasste Natur vollkommen dem Menschen zu verdanken ist – er rettete die vor über 100 Jahren fast ausgestorbenen Vögel und päppelte sie derart erfolgreich auf, dass sie heute zur Plage geworden sind und sich von den Müllhalden der Metropole ernähren. Wir lernen: auch die Natur ist »künstlich« und auch künstliche Natur bedroht den Menschen. Schade, dass Monsieur Latour hierzu jetzt nicht mehr seine Meinung sagen kann.
+ + +
In anderen Filmen entstehen Flüsse oder sie fließen unter der Stadt durch unterirdische Betonstraßen, Felsen sprechen und Menschen beschwören die Kraft der Naturgesetze. Der Film Oscurana aus Honduras zeigte Wanderungen der Menschen durch sich wandelnde Landschaften.
Melt vom bekannten österreichischen Regisseur Nikolaus Geyrhalter ist in diesem Feld eine »sichere Bank«. Der Slow-Cinema-Style Geyrhalters und seine Vorliebe für menschenarme Räume kommt dem Ziel entgegen, im Hier und Jetzt posthistorische Kulissen aufzuspüren, in denen allenfalls Maschinen noch handeln. Der Filmemacher zeigt die Eiswüsten der etwa zwei Prozent der Erdoberfläche, die von gefrorenem Wasser bedeckt ist. Der Großteil unseres Süßwassers ist darin gespeichert, und wird mit dem Klimawandel freigesetzt. Geyrhalter findet auch in seinem jüngsten Werk die von ihm gewohnten opulenten Bilder, diesmal einer Welt aus Eis und Schnee. Auch zeigt er das Leben der Eskimos in Kanada und wie die Schneekanonen im französischen Val d’Isère den Ski-Tourismus retten.
Melt widerlegte allerdings auch Latours Ideen, denn er zeigte oft Verhältnisse, in denen die Menschen nicht erst heute, sondern jeher der Natur und ihrem Regime gehorchen müssen
+ + +
Andere Filme blickten weg vom Natur-Mensch-Verhältnis auf die Menschen selbst, und was sie einander antun.
So auch der kroatische Film Peacemaker vom Regisseur Ivan Ramljak, der sich kritisch mit den Gründungsmythen seiner Nation auseinandersetzt und den faschistischen Kern des nationalistischen Aufstands der Kroaten gegen den jugoslawischen Staat freilegt.
Der Film beginnt mit historischen Szenen von Menschen in Panik, weinend und in Tränen aufgelöst. Sie werden von einem Fernseh-Reporter interviewt; soeben ist der Polizeichef von Osijek, Josip Reihl-Kir, zusammen mit zwei weiteren Beamten auf offener Straße von kroatischen Polit-Hooligans ermordet worden, während er versuchte, zwischen der serbischen und der kroatischen Seite in der ostkroatischen Region Slawonien zu vermitteln. Diese Episode vom 1.7.1991 war eine der ersten im jugoslawischen Bürgerkrieg. Ob es sich um einen Auftragsmord handelte, ist bis heute unklar und nach Lage der Dinge eher unwahrscheinlich.
+ + +
Der Film bietet erstaunliches Material: Ein Interview mit dem einzigen Überlebenden des Mordes, und Filmmaterial des kroatischen Fernsehens, das dort nie ausgestrahlt wurde und bis heute nicht öffentlich zugänglich ist, weil es zu kompromittierend für die kroatische Seite ist.
Der Film handelt von den gesellschaftlich-politischen Umständen, die zum Bürgerkrieg geführt haben. Regisseur Ramljak kommentierte seinen Film auch als »Versuch zu zeigen, dass es ein anderes Kroatien gibt«. Die kroatische Gesellschaft sei »tief gespalten, wie viele Gesellschaften weltweit – von Serbien bis zu den USA«. Er glaube, so Ramljak, »wir sind Zeugen eines Versuchs einer konservativen Revolution, die von einer lautstarken und aggressiven Minderheit gegen eine stille und träge Mehrheit geführt wird.«
+ + +
Der wichtigste Preis in Leipzig ist aber der Hauptpreis im deutschen Wettbewerb. Ihn gewann die Berliner Regisseurin Yulia Lokshina für ihren Film Active Vocabulary. Auch wenn der »Mitteldeutsche Rundfunk«, Teil der ARD, diesen Film irrwitzigerweise als »Film aus Russland« bezeichnete, handelt es sich um ein deutsches Werk, das größtenteils in Berlin spielt und gedreht wurde.
Ohne Senderbeteiligung produziert, erzählt die Regisseurin auf mehreren Erzählebenen von einer widerständigen russischen Lehrerin, die von ihren Schülern Anfang 2022 als Kriegsgegnerin denunziert wurde und das Land verlassen musste. Jetzt arbeitet sie in Berlin, darf aber aufgrund der umständlichen deutschen Gesetzeslage trotz Lehrermangels noch nicht wieder in ihrem Beruf arbeiten.
Diese Episode nimmt Lokshina zum Anlass einer Art Diskursarchäologie, die Schichten der russischen Gesellschaft und der Stadtplanung für ein neues »Groß-Moskau« mit grundsätzlichen Überlegungen zur Institution Schule und dem Heranwachsen verbindet, und in der Schüler einer Berliner Klasse aus Berlin-Moabit die Erlebnisse der Lehrerin rekonstruieren.
Vor allem aber geht es um Indoktrination und Manipulation in sozialen Netzwerken, und den Kampf um die Wahrheit. Lokshinas Filmsprache ist experimentell und anspruchsvoll; formal verbindet sie Archivmaterial, Found Footage und 3D-Animation – ein Film wie gemacht für den Konzentrationsraum Kino.