Das weiße Band
| D/Ö/F/I 2009 · 144 min. · FSK: ab 12 Regie: Michael Haneke Drehbuch: Michael Haneke Kamera: Christian Berger Darsteller: Leonie Benesch, Josef Bierbichler, Rainer Bock, Christian Friedel, Burghart Klaußner u.a. |
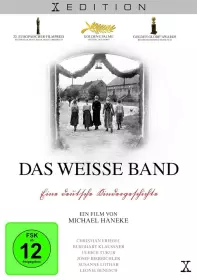 |
|
| Wo kommt das her? Wie konnte es dazu kommen? | ||
| (Plakat: Amazon) | ||
Die Farbe der Wahrheit
Schwarz und Weiß wie Gut und Böse: Michael Hanekes Siegerfilm aus Cannes zeigt protestantischen Fanatismus und die Erziehung vor Auschwitz
»Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er; er schlägt mit der Rute jeden Sohn, den er gern hat.« – Die Bibel, Hebräer, 12.6
»Der Herr straft der Väter Missetat an den Kindern, bis ins dritte Glied.« – Mose 4. 14,18
Es gibt kein richtiges Leben im falschen. Wir aber, das hat Michael Haneke in allen seinen Filmen immer wieder betont, und uns damit nicht nur den Spiegel vorgehalten, sondern das Urteil gesprochen, wir alle miteinander leben ungeachtet gewisser Fortschritte, und die augenfälligen Rückschritte konsequent ignorierend, ganz und gar ein falsches Leben: Unbewusst, stumpf, kalt, angstgetrieben, von Freiheit und Wohlstand nicht etwa befreit, sondern noch mehr verdorben, in einer, wie es der wunderbare ZEIT-Redakteur Thomas Assheuer in einem Haneke-Text treffend auf den Punkt gebracht hat, »politisch gewollten Lebensversäumnis-Anstalt«. Wo kommt das her? Wie konnte es dazu kommen? Hanekes neuester Film, der in Cannes mit der »Goldenen Palme« prämierte »Das Weiße Band«, gibt eine Antwort.
+ + +
Ein Film ist ein Film. Auch wenn er von Michael Haneke stammt. Es gibt nun aber Menschen, die sehen bei Hanekes Filmen immer das Gleiche. Das heißt: Eigentlich sehen sie gar nichts. Es ist typisch, dass, wenn jetzt Das weiße Band ins Kino kommt, manchen Filmkritikern auch nur wieder die üblichen fünf Schlagwörter aus der Haneke-Phrasendreschmaschine einfallen: »Vergletscherungstheorie« – eine »1« dafür, bitte setzen! –; »pädagogischer Furor«; und, oje oje: »Gewalt-Reflexionen«; dann, nicht vergessen bitte: die »Medienkritik«; sowie, natürlich, genau: Die »düstere Weltsicht«. Wobei einem gleich die Frage auf die Lippen huscht, ob denn wirklich Hanekes Weltsicht so düster ist, oder nicht eher die Welt, von der seine Filme handeln, zumindest ein wenig vielleicht? Wenn man dann auch noch zufällig gern ein Buch zu David Lynch geschrieben hätte, heißt es noch: »Alles ist wie Twin Peaks , bloß in Schwarzweiß«, nur weil die Handlung in einem Dorf spielt, und ein Verbrecher gesucht wird.«
Das ist ja alles nicht völlig falsch. Es ist aber auch nicht besonders einfallsreich, vielmehr ziemlich banal. Denn all das findet man zwar in Das weiße Band, vom Film weiß man danach aber immer noch gar nichts. Und weil ein Film eben ein Film ist, darf man vielleicht erst einmal, bevor wir auf all das kommen, wovon er handelt, hingucken und daran erinnern, wie er aussieht.
+ + +
Schwarzweiß. Wie alte Filme, wie die Filme von Bergman, die Ähnliches im Sinn führen, wie Heimat von Edgar Reitz. Auch Das weiße Band war ursprünglich, vor vielen Jahren mal als Fernseh-Miniserie in drei Teilen konzipiert, konnte dort aber schon seinerzeit nicht realisiert werden. Schwarzweiß – das liebt Haneke einfach, wie er sagt, und wer es sieht, versteht warum: Überaus klar sieht es aus, brillant und scharf, trotzdem nicht zu kontrastreich. Es ist weicher und wirkt damit wärmer als das spätexpressionistische Schwarzweiß des Film Noir; es ist fähig zu Dutzenden von Abstufungen und Nuancen, zu 'zig Schattierungen. Es erinnert an die Photographien von August Sander und anderen Fotokünstlern des frühen 20. Jahrhunderts. Ein leichtes Sepia mischt sich in dieses Schwarzweiß, das daher noch altertümlicher und weiter hergeholt wirkt. Es ist ein Schwarzweiß, das direkt ins visuelle Gedächtnis des Zuschauers eindringt, es freilegt für den Film, auf dass beide verschmelzen. Schwarz und Weiß wie Tage und Nächte. Schwarz und Weiß wie Wahrheit und Lüge. Schwarz und Weiß wie Gut und Böse.
Dieses Schwarzweiß besitzt eine Klarheit, Reinheit, die mit dem Inhalt des Films zu tun hat, die erinnert an den protestantischen Rigorismus und Reinheitsterror im evangelischen Pfarrhaus, und im Kontrast natürlich auch an den Titel des Films. Dieses Schwarzweiß verstärkt noch den Erzählton des Films, der etwas Dokumentarisches hat; es wirkt wie eine historische, philosophische, ethnologische Studie.
+ + +
»Die weiße Farbe soll Euch an Unschuld und Reinheit erinnern« – wer »gesündigt« hat unter den Pfarrerskindern, bekommt von den Eltern eine weiße Schlaufe ans Haar oder den Arm, ein Ritual, das im Pfarrhaus üblich ist und dem Film den Titel gibt: »Das Weiße Band«. Das ist, so reich an Themen wie präzise in seiner Milieuzeichnung, ein überaus genau recherchierter Film – und die Sache mit dem weißen Band stammt aus einem protestantischen Erziehungshandbuch, das seinerzeit fortschrittlich war – Bänder sind natürlich sanfter, als Schläge.
Das weiße Band, das nicht ohne Erlaubnis abgelegt werden darf, markiert den Sünder, stellt ihn an den Pranger und macht ihn zum Sündenbock, es grenzt ihn aus. Wie später der Judenstern andere. Das fiktive Dorf, in dem »Das Weiße Band« spielt, heißt Eichwald, und so wenig, wie Haneke anderes dem Zufall überlässt, ist er sich natürlich bewusst, dass dieser idyllische Name, aus den Namen »Eichmann« und »Buchenwald« zusammengesetzt ist.
+ + +
Das weiße Band ist in vielem ein ungewöhnlicher Haneke: Erstmals seit 1996 hat der Österreicher wieder auf Deutsch gedreht, in einem Dorf in der Uckermarck, das wirkt wie nach hundert Jahren frisch aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Dort siedelt Haneke das Portrait eines kleinen norddeutschen Dorfes im Jahre 1913/14 an: Es gibt den Gutsherrn (Ulrich Tukur) und den Lehrer (Christian Friedel), den Arzt (Rainer Bock) und den – natürlich evangelischen – Pfarrer (Burghart Klaussner in einem absolut sensationellen Auftritt), den Verwalter (Josef Bierbichler), die Bauern. Es gibt die Frauen (Leonie Benesch, Ursina Lardi, Steffi Kühnert, Susanne Lothar). Und vor allem die Kinder. Lauter Archetypen. Das Leben geht seinen Gang, sonntags fehlt keiner in der Kirche und man singt »Ein feste Burg ist unser Gott«, und zu Erntedank wird der Psalm 104 gelesen – »Aller Augen warten auf Dich, Herr, und Du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.« –, dann darf man sich besaufen.
Es geht also weniger um Klassenunterschiede, auch nicht um Bildungsdifferenzen, denn wie wenig das bringt, kann man immer hier wieder sehen, auch wenn der Lehrer, in diesem Film als Vertreter eines gewissen Bildungshumanismus auch Erzähler aus dem Off, ein wenig zum Hort des Guten wird. Mehr geht es um die Brutalität, die alle Teile der Gesellschaft über ihre Unterschiede hinweg gemeinsam durchdringt, um die Wahrheit hinter dem etwas zu idyllischen Bild jener »Welt von Gestern« (Stefan Zweig), die durch den Sommer von Sarajewo unrettbar zerstört wurde. Eine Zeit, die eben nur im nostalgischen Rückblick mit sich im Reinen war, und von Zuversicht geprägt. »Böswilligkeit, Neid, Stumpfsinn und Brutalität...«, so beschreibt hier einmal eine Figur die universale Primitivität, die sie umgibt. Die Kinder spiegeln, was ihnen geschieht: Väter die ihre Kinder prügeln, sie nachts ans Bett fesseln, damit sie nicht onanieren können, oder sie sexuell missbrauchen.
+ + +
Sonderbare Vorkommnisse ereignen sich schon in den ersten Minuten, die Verdacht, Misstrauen und Unbehagen nach sich ziehen. Und neue Taten: Ein dünnes Drahtseil wurde zwischen zwei Bäume gespannt, das Pferd des Arztes fällt darüber und dieser verletzt sich schwer. Eine Holzdecke bricht ein, worauf eine Arbeiterin zu Tode kommt. Der Sohn des Barons wird misshandelt. Eine Scheune brennt ab. Der behinderte Junge der Hebamme wird brutal zusammengeschlagen und an einen Baum gefesselt. Der Versuch, das Geschehen aufzuklären, treibt die Handlung voran.
Doch vor allem treibt sie das Vergehen der Zeit selbst. »Das Weiße Band« bietet in Form eines Soziotops eine mikroskopische Reflexion der deutschen Gesellschaft, der wilhelminischen Gesellschaft, einer Gesellschaft – und unser Wissen darum ist hier immer mit präsent –, die nur noch auf Abruf da ist und sich bald in den Materialschlachten des Ersten Weltkriegs auflösen wird; der reflektiert den Ausgang dieser Gesellschaft und das Ende jenes von Vorahnungen und Überdruß geprägten »Zeitalters der Nervosität« (Joachim Radkau).
Auch wenn es so scheinen mag: Hier ist an sich nichts böse und nichts gut, keiner der Menschen, noch nicht mal der Pfarrer, ist grundsätzlich ein böser Charakter, keiner, höchstens der Lehrer, ist ein wirklich sympathischer, sondern alle sind Menschen, die man in und aus ihrer Epoche verstehen muss: Teile dieser bereits verklingenden feudalen Gesellschaft, verlorene Charaktere, die berühren, weil sie spüren, dass sie nur noch kurze Zeit vorhanden sind.
+ + +
Es gibt einen Erzähler in Das weiße Band, es handelt sich keineswegs zufällig – aber was ist schon Zufall bei Haneke – um den Lehrer des Dorfes. Er ist einer der wenigen, der von Außen kommt, und als solcher perfekt geeignet zum Beobachter. Auch wenn der Lehrer hier als einziger Erzähler fungiert, zeigt der Film aber vieles, was der Lehrer nicht erlebt haben kann. Später wird der Lehrer sich in die noch jugendliche Eva verlieben, die als Kindermädchen beim Baron arbeitet. Leonie Benesch verkörpert großartig dieses Wesen von entwaffnender Naivität und strahlender Unschuld. Das Paar, das hier zarte Bande knüpft, bleibt die eine warmherzige Ausnahmeerscheinung in diesem Film – nicht zufällig kommen beide Menschen nicht aus diesem Dorf, sondern von außerhalb. (Allerdings zeigt genaueres Erinnern auch, wie viele hier selbst in dem überschaubaren Dorf eigentlich nicht wirklich von dort stammen: Die Baronin, der Verwalter, der Arzt – ein Reflex auf die Mobilität der Gesellschaft bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert. Über die Pfarrersfamilie wird in der Hinsicht nichts erzählt, doch zumindest wird der Pastor irgendwo studiert haben.)
Den Lehrer lernen wir jung kennen, er ist durchaus schüchtern, sich auch der Grenzen seines Standes und seiner Möglichkeiten bewusst; er lebt ein eher karges Leben, dessen Glück sich am ehesten noch in der Musik findet. Aber er ist auch aufgeschlossen, offen, versteht die Kinder ein wenig, und spricht eine modernere Sprache, die auch von den Kindern eher verstanden wird. Dieser Lehrer erzählt die Geschichte des Films im Rückblick als alter Mann. Wir wissen nicht, zu welchem Zeitpunkt dies genau sein soll, aber es handelt sich hörbar zumindest um einen 70-jährigen, und da der Lehrer, das erfahren wir irgendwann, zum Zeitpunkt der Filmhandlung Anfang 30 ist, könnte die Erzählung sich ungefähr gegen Mitte, Ende der 50er-Jahre ereignen. Über der Erzählung liegt der Schatten dessen, was ihr folgt: Der Erste Weltkrieg, die Zeit der Weimarer Republik, die Nazi-Diktatur mit ihren Verbrechen und der Zivilisationsbruch der Shoah.
+ + +
Vom Zivilisationsbruch handelt auch die Geschichte von Das weiße Band. Die Erzählung ist eine Parabel. Der Erzähler als Erzieher, nicht etwa umgekehrt. Als Erzieher des Publikums. Die Verbrechen bleiben unaufgeklärt. Aber alles deutet darauf, dass die Kinder die Täter waren. Diese Kinder sind vor allem die der moralischen Autoritäten dieser Gemeinschaft, sie sind Opfer und Täter zugleich. Sie tun Böses, auch um sich zu schützen – vor dem Bösen. »Die Kinder werden gestraft für die Sünden der Eltern« heißt es einmal. Die Kinder müssen die Last ihrer Herkunft, das Erbe der Eltern tragen. Sie bestrafen die, die anders sind, aber sie bestrafen damit auch sich selbst. Trotz ihrer Individualität agieren sie als Kollektiv.
Unschuld und Sünde, Schuld und Verantwortung, Erziehung und Strafe – einmal mehr stellt Michael Haneke in »Das Weiße Band« Facetten des Menschlichen und Rituale der Gesellschaft auf den Prüfstand und entdeckt das Böse als untrennbaren Bestandteil eines jeden sozialen Zusammenhangs.
+ + +
Es gibt nun mehrere Perspektiven, unter denen man das alles betrachten kann. Keine ist privilegiert. »Das Weiße Band« funktioniert wie ein Kaleidoskop: Je nachdem, wie man es dreht und man hineinschaut, so verändert sich der Film.
Da ist zum einen der Protestantismus: Die seltsame Logik eines strengen Vaters, der aus Liebe züchtigt, konsequent zuende gedacht ein sadomasochistischer Charakter ist, und seine perversen Erziehungsmethoden. Das weiße Band ist ein Lehrstück, in dem der Protestantismus als exemplarisches Beispiel und die historische Epoche als Folie dient, um den Zusammenhang von Macht, Zwang und Gewalt zu ergründen. Das Hanekes Filme mehr sind, als die oft erwähnte Medienkritik, dass sie noch weit mehr als Elternkritik und Erziehungskritik verstanden werden müssen, ist schon öfters ausgeführt worden – »Das Weiße Band« untermauert diese These mit vielen zusätzlichen Argumenten.
So ist dies, zweitens, natürlich eine ganz grundsätzliche Geschichte über Gewalt und ihre Genese. darüber wie Gewalt entsteht und wo sie hinführen kann. Haneke beschreibt die Geburt der Gewalt aus dem Geiste des Autoritarismus. Erziehung vor Auschwitz. Nichts Neues. Aber gut und differenziert begründet.
Es ist damit – drittens – eine Vorgeschichte des Faschismus. Der Film zeigt in den Kindern die Erwachsenen von morgen. Und es ist genau die Generation, die 1933 Ende 20, Anfang 30 Jahre alt sein wird. Die Kinder wurden missbraucht und misshandelt und genießen insofern mildernde Umstände, sie haben die Werte ihrer Eltern aber auch verinnerlicht, und sind damit deren Repräsentanten. Sie stehen für alles Falsche, Perverse, Verbrecherische jener Zeit.
Schließlich – viertens – ist der Film eben »eine Kindergeschichte«. So hätte er heißen sollen. Diese Kinder sind auch als Kinder ernst zu nehmen. Das heißt, sie sind nicht nur die späteren faschistischen Erwachsenen, sondern bereits eine HJ avant la lettre, eine HJ des Wilhelminismus. Kinder, die als Kinder boshaft und verschlagen sind und darin idealistisch und von sich selbst überzeugt. Und die sich zu radikalen Richtern ihrer Eltern aufschwingen, die auch zur Bedrohung für sie werden.
Zugleich sind sie Figuren aus einem Horrorfilm: Die Präsenz der Kinder, ihre Blicke auf die Erwachsenen, scheint, vor allem, wenn sie in Gruppen auftreten, immer etwas Anklagendes zu haben, etwas Unheimliches auch. Man kann »Das Weiße Band« daher ganz und gar als Horror-Mystery begreifen, nur ist eine solche Betrachtungsweise im Fall von Haneke etwas unüblich.
+ + +
Manche Gesellschaftstheoretiker sind überzeugt: Verbrechen sind dazu da, um eine Gesellschaft zu stabilisieren, durch ein komplexes Geflecht aus Strafe und Angst. Verbrechen können aber eine Gesellschaft auch destabilisieren. Genau diese Dialektik zeigt Haneke: Die Gesellschaft reagiert auf die Unfälle, Merkwürdigkeiten und Verbrechen zunächst solidarisch. Doch zunehmend wird sie durch sie innerlich ausgehöhlt. Haneke zeigt eine Gesellschaft, die sich ihrer eigenen Abgründe nicht stellen will, will sich die Ursachen der Vorgänge nicht bewusst machen, weil sie instinktiv spürt, dass diese in ihr selbst liegen. Diese Verdrängung verschärft die Spannung und gebiert neue Untaten.
Auch wenn all dies nicht explizit gemacht wird, so vermittelt Haneke doch deutlich genug für alle, die Augen haben zu sehen, Ohren zu hören und einen Verstand zum denken, dass der gezeigte Gewalt- und Schreckenszusammenhang konsequent in den Faschismus mündet. Die Verbindung ist keine historische, eine moralische aber sehr wohl. Haneke, der subtiler ist, als er dem einen oder anderen scheinen mag, bietet in Das weiße Band auch sämtliche geläufigen Motive auf, die den Faschismus konstituieren: Konformismus, rigorose Disziplinierung, patriarchalische Macht, sexuelle Repression, Verdrängung, ein Klassensystem, soziale und materielle Ungleichheit, die Kreation von Sündenböcken aus Außenseitern.
+ + +
So überzeugend das ist, so sind doch die Parallelen zur Gegenwart kaum weniger naheliegend: Das weiße Band leuchtet hinein in das Dunkel, das unter den scheinbaren Sicherheiten von Familie, Ordnung, Bürgerlichkeit liegt; der Film zeigt, dass Bildung nicht vor Verbrechen schützt, er zeigt, wie Religion geradezu zwangsläufig in Fanatismus mündet.
Einmal mehr spielt Haneke mit Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. Obwohl der Film vom Schuldig-werden, Urteilen und Strafen handelt, bringt er den Zuschauer nie in eine Position, die ihm selbst ein sicheres Urteil erlaubt. Die Verbrechen bleiben ungeklärt und ungestraft. Die Strafe wird später folgen, und sie wird härter sein, oder, wie es heißt »der Herr straft der Väter Missetat an den Kindern, bis ins dritte Glied.«
Wo kommt das her? Wie konnte es dazu kommen? Das weiße Band gibt die Antwort. Viele werden es nicht hören wollen, aber, wer nicht hören will, das steht nicht nur in protestantischen Erziehungsratgebern, muss fühlen.
»Ein Jahr ist kurz – da stürzt die Welt nicht ein« heißt es einmal, um Weihnachten 1913/14. Aber genau das ist passiert. Die Welt ist eingestürzt. So wie unsere, irgendwann.