Revolution als Chance für einen filmischen Neuanfang? |
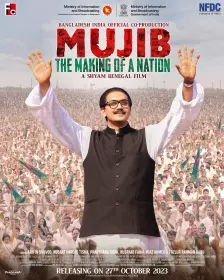 |
|
| Im ideologischen Korsett der letzten Regierung entstanden – Shyam Benegals großer Erfolg Mujib: The Making of a Nation | ||
| (Plakat: Wikicommons) | ||
Für die Filmindustrie Bangladeschs bedeutete die politische Revolution im Sommer 2024 die Chance auf einen Neuanfang. Doch ein analytischer Blick auf die gegenwärtige politische Lage und andere Umstürze der Weltgeschichte lassen Zweifel aufkommen, ob es je ein »unabhängiges« Filmemachen in Bangladesch geben wird
Von Bidhan Rebeiro
Die Rufe nach Reformen in Bangladesch haben seit dem letzten Sommer und mit der Vertreibung der despotischen Regierung unter Sheikh Hasina an Dynamik gewonnen und sind in verschiedenen Bereichen, darunter auch in der Filmindustrie, inzwischen sehr laut zu hören. Vor dieser Welle des Wandels waren viele Filmemacher eng mit der Regierung unter der Awami-Liga verbandelt. Mit dem Ausbruch des Aufstands befürchteten einige eine düstere Zukunft und hofften auf eine bessere Lösung. Nach dem politischen Wandel der ersten Proteste erwiesen sich diese Erwartungen jedoch oft als falsch. Zahlreiche bislang Gemäßigte empfanden die Regierungsführung der Awami-Liga nun als zu autoritär und begannen, ihre Unterstützung für den Volksaufstand zu bekunden, der Ende Juli begann und ab dem 1. August immer mehr an Fahrt gewann.
An diesem Tag versammelten sich in Dhaka zunächst Fernsehschaffende und unabhängige Filmemacher vor dem Parlamentsgebäude. Wegen heftigen Regens und des Widerstands der Polizei lösten sie sich auf, aber einige versammelten sich erneut am Farmgate in der Nähe eines Kinosaals, wo sie Transparente und Plakate in den Regen hielten. Andere Kulturschaffende schlossen sich bald aus Solidarität an. Am nächsten Tag, dem 2. August, gingen weitere Künstler auf die Straße und versammelten sich am Central Shaheed Minar, einem Nationaldenkmal in Dhaka. Wir alle kennen die Folgen dieser Versammlung und wissen, wie sich das politische Szenario in Bangladesch verändert hat. Der 5. August war ein Wendepunkt für das Land und die gesamte südasiatische Region. Innerhalb weniger Tage setzten sich die Filmemacher und Künstler, die sich physisch oder virtuell am Protest beteiligten, ernsthaft für Reformen im Filmbereich ein.
In der Zeit nach dem Aufstand kam es zu einem breit angelegten Dialog, bei dem unterschiedliche Meinungen über die weitere Entwicklung der Filmindustrie des Landes zum Ausdruck kamen. Die erste große Veranstaltung, die von der Bürgerinitiative »Juli Public Sphere« im Nationalmuseum in Shahbagh organisiert wurde, beinhaltete eine Grundsatzrede mit dem Titel »Kulturpolitik: Kino als Vorwand« des Filmemachers Kamar Ahmad Simon. Dies löste eine Welle von Aktivitäten unter unabhängigen Filmemachern, Filmpädagogen und Studenten aus.
Die Bemühungen um die Einrichtung einer Nationalen Filmkommission begannen mit einem Entwurfsausschuss, der sich mit prominenten Persönlichkeiten der Zivilgesellschaft beriet. Die Gründung der Kommission war mit einem Fahrplan für eine Filmreform verbunden, die ein breites Spektrum von Perspektiven einbeziehen sollte. Reformvorschläge kamen auch von Studenten des Bangladesh Cinema and Television Institute (BCTI). Gleichzeitig wurden innerhalb der Bangladesh Film Development Corporation (BFDC) zwei neue Ausschüsse gebildet: der Ausschuss zum Schutz der Filmrechte vor Diskriminierung und das Bangladesh Film Development Forum. Außerdem begannen Organisationen wie das Centre for Asian Arts and Culture, Diskussionen über das nationale Kino zu veranstalten.
Unterhaltungsjournalisten aus dem Umfeld der elektronischen Medien organisierten ein Seminar, an dem auch Filmemacher aus dem Mainstream teilnahmen. Sie diskutierten über die Notwendigkeit von Reformen oder strukturellen Veränderungen. Zu den Themen gehörten die Einführung von E-Ticketing und eines Kassensystems, um finanzielle Transparenz zu gewährleisten und die Korruption im staatlichen Steuersystem einzudämmen. Die Teilnehmer betonten auch die Notwendigkeit, Filmförderungen als leistungsbezogene Stipendien zu vergeben, und forderten Arbeitsplatzsicherheit für Künstler und Techniker.
Da junge Menschen die treibende Kraft hinter dem Aufstand waren, traten viele aufstrebende Filmemacher den Filmzertifizierungsgremien und -ausschüssen bei und wurden sogar Teil der Suchausschüsse des Informationsministeriums. Doch wie schon zuvor gab es auch in diesen Ausschüssen Beschwerden über die bürokratische Dominanz. Sogar in den Medien wurde über die Unzufriedenheit der kommerziellen Künstler mit den neu gebildeten Foren im BFDC berichtet. Nichtsdestotrotz bleibt die gemeinsame Hoffnung auf einen sinnvollen Wandel, eine Abkehr von den bisherigen Praktiken und eine auf Integrität aufgebaute Zukunft.
Wir können nicht ignorieren, dass die Korruption eine wirtschaftliche Grundlage hat, und wenn die Korruption plötzlich zum Stillstand kommt, unterbricht sie die Finanzströme und macht viele arbeitslos. Machtwechsel stiften oft Verwirrung und lassen Investoren zögern, und diejenigen, die zuvor mit der alten Regierung verbündet waren, geraten in eine schwierige Lage. So können beispielsweise Projekte, die mit der früheren Regierung in Verbindung stehen, auf Eis gelegt werden, so wie das Biopic Mujib: The Making of a Nation, das die ebenso wichtige historische Figur des Ziaur Rahman vund damit ein klares Awami-Liga-Projekt ist, oder wie Sheikh Mujibur Rahman, der während der Amtszeit der BNP oft beiseite geschoben wurde. Die Filmindustrie spiegelt diese Muster selektiver Geschichtsdarstellung nur allzu gut wider, je nachdem, wer gerade an der Macht ist.
Unser Kino ist nicht losgelöst von unserem kulturellen oder historischen Kontext; es hat sich schon immer mit fragmentierter Geschichte beschäftigt. Wenn eine neue Regierung an die Macht kommt, passen Filmemacher ihre Erzählungen schnell an ihre Agenda an. Das war schon immer die Norm, vor allem unter einer parteiischen Regierung. Die Informationen, die Filme vermitteln sollen, verfälschen oft die Wahrheit. Halbwahrheiten können gefährlicher sein als Lügen. So bleibt unvoreingenommenes, unabhängiges Filmemachen in unserem Land ein ferner Traum.
Mehr als anderthalb Jahrzehnte autoritärer Herrschaft schufen eine besondere Dynamik in der Filmindustrie. Viele, darunter talentierte Filmemacher und Schauspieler, arbeiteten aus der Not heraus an staatlich geförderten Projekten. Doch nach dem Volksaufstand wurden diese Künstler als Kollaborateure des Regimes betrachtet und sahen sich mit Gegenreaktionen konfrontiert. Produktionen, an denen sie beteiligt waren, wurden gestoppt, und Schauspieler in Nebenrollen verloren ihre Arbeit. Der Aufstand hat zwar ein autoritäres System beseitigt, aber auch neue Herausforderungen mit sich gebracht.
Die Akteure der Filmindustrie bemühen sich um eine Umstrukturierung des Sektors, doch der tatsächliche Wandel ist ein Unterfangen, das sich über zwei Jahrzehnte hinziehen kann. Künstler, die mit unmittelbaren finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, brauchen kurzfristige Lösungen. Auch die Zukunft der laufenden Projekte ist ungewiss. Daher wurde bei vielen Treffen und Gesprächen nach dem Aufstand der Schwerpunkt auf kurz- und langfristige Pläne für die Entwicklung der Filmindustrie gelegt.
Zu den diskutierten Sofortmaßnahmen gehören die Suche nach Möglichkeiten zur Wiedereingliederung von Künstlern in den Arbeitsmarkt und die Schaffung eines stabilen Umfelds. Der Abbau der bürokratischen Kontrolle in der Filmbildung und in den Branchenausschüssen, die Sicherstellung einer besseren kulturellen Vertretung und die rasche Einführung von E-Ticketing und eines Kassensystems wurden als vorrangige Maßnahmen genannt. Die Regierung wurde auch aufgefordert, Steuervergünstigungen für die Branche zu prüfen.
Langfristige Pläne sehen die Einrichtung eines Filmrates vor, der bei Bedarf mehrere Kommissionen beaufsichtigen und das Durcheinander in der Branche beseitigen soll. Der BFDC könnte zu diesem Zweck umgestaltet werden, und es könnte ein Filmzentrum eingerichtet werden, in dem unabhängige Filme gezeigt und Festivals veranstaltet werden. Auch Filmbildungseinrichtungen würden diesem Rat unterstellt werden.
Diese Pläne wurden in verschiedenen Foren als Forderungen vorgestellt. Kurzfristige Ziele konzentrieren sich auf realisierbare Reformen, während langfristige Reformen Geduld erfordern. Eine weitere kritische Forderung ist die Abschaffung von Gesetzen, die die Redefreiheit einschränken. Sie wurde von einer Gruppe junger Filmemacher mit dem Namen »Film Reform Roadmap 24« erhoben. Diese Forderung scheint gerechtfertigt, da strengere Zertifizierungs- und Zensurbestimmungen durchgesetzt werden, die die kreative Freiheit einschränken.
Die Kultur des offenen Dialogs und der gestiegenen Erwartungen nach dem Aufstand ist eine positive Veränderung gegenüber der Vergangenheit. Früher äußerten die Filmschaffenden ihre Frustration privat, jetzt suchen sie nach gemeinsamen Lösungen und stimmen ihre Forderungen mit den staatlichen Kapazitäten ab. Neben den Diskussionen haben Dokumentarfilmprojekte über den Aufstand begonnen, von denen einige bereits abgeschlossen sind. Selbst der kommerzielle Filmemacher Raihan Rafi hat einen Film über den Aufstand angekündigt, in dessen Mittelpunkt ein junger Aktivist namens Mughdho oder das Ereignis selbst stehen könnte.
Die Filmindustrie hat von allen Sektoren den energischsten Vorstoß für Veränderungen erlebt. Zwar wurden auch Themen wie die Reform des Hochschulwesens erörtert, doch die Zahl der filmbezogenen Initiativen, Veröffentlichungen und Dokumentarfilme ist beispiellos. Auch wenn es zu anderen Themen Proteste auf der Straße gab, haben Filmschaffende ihre Bedenken in Foren geäußert und so Kontinuität in ihre Diskussionen gebracht.
Die Energie, die das Kino umgibt, beweist, dass es sich in Bangladesch zu einer einflussreichen Kunstform entwickelt hat, auch wenn die Branche noch zu kämpfen hat. Wenige kommerzielle, mittlere und unabhängige Filme geben dieser Hoffnung Auftrieb. Wenn wir jährlich mindestens fünf kommerziell erfolgreiche Filme und ein Dutzend kostendeckende Projekte auf die Beine stellen könnten, würde dies die Branche stärken und auch den unabhängigen Film fördern.
Manche nennen den Aufstand vom Juli eine zweite Unabhängigkeit oder »Bangladesch 2«. Ich stimme dem nicht zu, aber es ist unbestreitbar, dass der Befreiungskrieg von 1971 einen bedeutenden Wandel in der Filmindustrie ausgelöst und den bengalischen Nationalismus in den Vordergrund hat. Der heutige Kontext ist jedoch ein anderer. Wir sind jetzt eher mit einheimischer Ausbeutung als mit kolonialer Unterdrückung konfrontiert. Der Aufstand hat die wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheiten nicht grundlegend verändert, aber er hat ein autoritäres Regime gestürzt. Echte Demokratie ist nach wie vor schwer zu erreichen.
Der Vergleich zwischen Bangladesch und dem Iran nach der Revolution zeigt, wie ein ideologischer Wandel das Kino verändern kann. Bangladeschs Forderung nach Filmreformen ist eher pragmatisch und zielt eher auf die Misswirtschaft der Branche als auf ideologische Veränderungen ab. Nach der islamischen Revolution von 1979 wandte sich das Land von Filmen ab, die sich an der westlichen Kultur orientierten, und begann, islamische Werte und Ethik im Kino in den Vordergrund zu stellen. Es wurden zahlreiche Beschränkungen für die Filmproduktion eingeführt, und die Zensurbehörde wurde umstrukturiert, um religiöse Werte zu berücksichtigen. Die iranische Filmindustrie stand kurz vor der Revolution vor großen Herausforderungen. So kamen beispielsweise 1978 bei einem Brandanschlag auf das von außen verschlossene Rex-Kino fast vierhundert Menschen ums Leben. Dieser Vorfall gab der Islamischen Revolution Auftrieb. Noch während der Revolution im Jahr 1979 wurden im ganzen Iran mehrere Kinos in Brand gesetzt. Doch das Kino als Kunstform erwies sich als unbezwingbar. Wie der mythische Phönix tauchte es im Iran als »Neue Welle« wieder auf und brachte Regisseure wie Dariush Mehrjui, Abbas Kiarostami, Mohsen Makhmalbaf, Jafar Panahi und Majid Majidi hervor. Ihre Filme brachten der Welt neue Erzählungen und innovative Geschichten.
Auch in Bangladesch kam es kurz nach dem Sturz der Regierung am 5. August zu einem gewalttätigen Angriff auf ein Cineplex in Rajshahi. Diese Filiale des Star Cineplex im Bangabandhu Hi-Tech Park wurde verwüstet und in Brand gesetzt. Glücklicherweise gab es keine Berichte über weit verbreitete Angriffe auf andere Kinos. Die Assoziation mit »Bangabandhu« (Vater der Nation, Sheikh Mujibur Rahman) könnte dieses Cineplex zu einem Ziel gemacht haben. Denn seine Tochter, Sheikh Hasina, war die abgesetzte Premierministerin. Solche Handlungen sind der Inbegriff von Engstirnigkeit. Anders als im Iran, wo ein Ideologiewandel die Filmindustrie beeinflusst hat, hat das Kino in Bangladesch diese Art von ideologischem Wandel nicht erlebt. Stattdessen wurden Forderungen laut, die sich mit den seit langem bestehenden Unregelmäßigkeiten und dem Flickenteppich in der Branche befassen. Obwohl die Regierung der Awami-Liga im Jahr 2013 das Bangladesh Cinema and Television Institute (BCTI) gründete, fehlten ihm viele wesentliche Merkmale eines richtigen Filminstituts. Das ist auch heute noch der Fall. Während der Amtszeit von Sheikh Hasina wurden zahlreiche Projekte initiiert. Doch oft ging es dabei um den Bau von Gebäuden zu überhöhten Kosten, wie aus Zeitungsberichten hervorging.
Die Erwähnung der iranischen Revolution lässt an die russische Revolution denken. Wladimir Iljitsch Lenin betonte oft, dass das Kino die wichtigste aller Künste sei. Folglich erließ die sowjetische Regierung nur zwei Jahre nach der Revolution, im Jahr 1919, einen Erlass zur Verstaatlichung der Filmindustrie. Außerdem wurde die weltweit erste Filmausbildungsstätte, die Russische Staatliche Universität für Kinematographie (VGIK), gegründet. Auch zahlreiche Filmstudios und Organisationen wurden gegründet. Mobile Kinoeinheiten wurden geschaffen, um Filme in entlegenen Gebieten vorzuführen. Auch wenn diese Einheiten Propagandafilme zeigten, gaben sie doch der Filmindustrie des Landes Auftrieb. Diese staatlichen Initiativen führten zur Entstehung von Filmgrößen wie Sergej Eisenstein, Wsewolod Pudowkin und Lew Kuleschow.
Von den 1960er bis zu den 1980er Jahren entstand inmitten verschiedener sozialer Umwälzungen in Lateinamerika eine Filmbewegung, die als Drittes Kino bezeichnet wird. Das Kino war nicht mehr nur eine Quelle der Unterhaltung, sondern wurde zu einem Instrument des politischen Aktivismus. Diese Bewegung hat später viele indische Filmemacher stark beeinflusst. Nach der Teilung Indiens im Jahr 1947 entstand in Indien eine parallele Kinobewegung. Die Winde des Wandels, die 1947 durch das Land fegten, fanden in den 1950er Jahren ihren Weg ins Kino, wobei sich die Filme nicht nur auf Liebe und Romantik konzentrierten, sondern auch auf Themen des Nationalismus, Säkularismus und Humanismus.
Daher ist es nur natürlich, dass sich das Kino nach einer Revolution oder einem bedeutenden sozialen Wandel in einem Land verändert. In Bangladesch ist es jedoch unwahrscheinlich, dass der Massenaufstand vom Juli/August zu tiefgreifenden Veränderungen im Kino führen wird. Der Grund dafür ist, dass der politische Wandel sich auf einzelne Personen beschränkte und nicht auf eine grundlegende Umgestaltung der Gesellschaft oder die Ablösung einer Klasse durch eine andere. Infolgedessen hat die Filmindustrie keine vollständige Umgestaltung erlebt und wird sie auch nicht erleben. Dennoch war der Aufstand angesichts der großen öffentlichen Beteiligung und Unterstützung, die er erfuhr, von Bedeutung. Das weckt natürlich Hoffnungen auf Reformen in der Filmindustrie, um sie voranzubringen. Ich hoffe, dass nicht nur ein nationaler Rahmen für die Filmindustrie geschaffen wird, sondern dass auch strategische Anstrengungen unternommen werden, um das Kino als Soft Power für Bangladesch zu etablieren, ein Thema, das ich in einem separaten Aufsatz ausführlicher behandelt habe.
Abschließend möchte ich ausführen, dass unabhängig von kurz- oder langfristigen Plänen für die Filmindustrie und unabhängig von den vielen Treffen und Seminaren, die wir abhalten, die Umsetzung dieser Ideen nur mit einem echten Engagement der Regierung möglich ist. Daher muss dem Film auf politischer Ebene die nötige Bedeutung beigemessen werden, damit sich im Filmsektor des Landes etwas ändert. Wenn die Regierung das Kino mit einer fortschrittlichen, demokratischen Einstellung wertschätzt, es als vielversprechenden Wirtschaftszweig betrachtet und kompetente Leute in den richtigen Positionen einsetzt, um es zu unterstützen, können die Wünsche der Filmgemeinschaft – dass bengalische Filme ein internationales Publikum begeistern, den heimischen Markt durch kommerziellen Erfolg erobern und Regisseuren die nötige kreative Freiheit bieten – verwirklicht werden.
Bidhan Rebeiro ist ein bengalischer Schriftsteller, Filmwissenschaftler, Filmkritiker, Dokumentarfilmregisseur und Geschäftsführer der Konvergenzmedienplattform Songbad Prokash. Er lebt und arbeitet in Dhaka, Bangladesch.
+ + +
Aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt von Axel Timo Purr.