Kein Ende, ein Anfang |
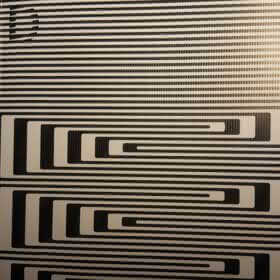 |
|
| Das Leben ist ein finsteres Tal... | ||
| (Foto: Rüdiger Suchsland) | ||
Auf den Tod folgt die Wiederauferstehung: Peter Schernhuber und Sebastian Höglinger feiern ihr Diagonale-Finale als ein historisches Special unter selbigem Titel – fast österliche Gedanken zu einer Diagonale-Reihe
»Um so schlimmer für die Tatsachen!«
– Hegel»Ois hädast di längst aufgebn wie aundre an Briaf
Dass gor ka Durchkumman mehr zu dir gibt
Auf Durchzug host gschoitn, waunn wer mit dir Redt
Waunnst ned boid wos mochst, nimmts a beses End«
– Voodoo Jürgens
Ende ist in jedem Kino. Manchmal heißt es »Fine« oder »Fin« manchmal »The End«, manchmal fällt es ganz weg, aber der Film hört trotzdem irgendwann auf. Und nicht nur der Film.
Es gehört zu jener Form der Lebenserfahrung, die man erst macht, wenn man einen größeren Teil des Lebens schon erfahren hat: Dass dieses Leben schneller vorbei ist, als man glaubt, und deswegen manchen Dingen, die man vor allem als Anfang und Aufbruch wahrnimmt, schon so etwas wie ein Ende und ein Abschluss innewohnt. Und plötzlich war es »damals am Schönsten«. Das Leben ist ein finsteres Tal.
Wie also soll man aufhören? Auch wenn man immer sagt: Es ist am besten, wenn man selbstbestimmt aufhört, so ist das Ganze dann doch oft ein bisschen weniger schön, wenn es soweit ist.
Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber, die als zwei Co-Direktoren acht Jahre und eine Pandemie lang die Diagonale geleitet hatten, haben sich für ihren Abschied den Titel »Finale« für das historische Special gegönnt. Ein Finale ist das Ende, aber oft fällt dieses auch mit dem Höhepunkt zusammen. Ganz bezugslos konnte man das in Graz nicht verstehen, erst recht nicht, weil beide in ihren »Vorgedanken« im Katalog sehr viel über das Ende nachdenken.
Das Ende ist Höhepunkt und Showdown in einem, das Schließen eines Bogens und Kreises, oder sogar die Hochzeit, mit der das Leben erst beginnt. Sie schreiben: »Die Winchester wird geladen, ein Liebespaar verliert sich im ersehnten Happy End, der Bösewicht versinkt im Lavastrom. An welche bestimmten drei Filme sie da wohl gedacht haben? Verlieren und versinken, katapultieren und geleiten und die Einsamkeit... Die weiße Leinwand am Ende ist die weiße Leinwand vom Anfang, nach dem Film ist vor dem Film.«
Heute kokettiert das Kino oft mit dem Herauszögern des Endes, damit das Böse immer nochmal aufsteht, dass das Ende nie wirklich ein Ende ist und es noch eine Post-Credit-Sequenz gibt. Immer noch eins draufsetzen: das ist die Kulturindustrie, die eben mit dem Bösen, das noch einmal aufsteht, untrennbar verbunden ist. Im Kino begann sie, in den Serien der heute »Streamingplattformen« genannten neuen Fernsehsender und ihrer Mainstreamkanonaden findet sie ihre jüngste Vollendung. Der erste Showrunner war der Serienkiller, und nicht zufällig trat der erste moderne Serienmörder, Jack the Ripper, 1888, fast zeitgleich mit der Geburt des Kinos ans Licht der Öffentlichkeit.
Ist Dramaturgie vielleicht so etwas wie der Beginn der Unsterblichkeit? Das Immer-wieder-Herauszögern des Endes? Auf den Tod folgt die Wiederauferstehung.
Apocalypse Now! Apocalypse How?
Vielleicht hängen auch die apokalyptische Rhetorik, die derzeit im Politischen en vogue ist, und die perverse Lust des Publikums an gesellschaftlichen Dystopien, an durch klimatischen Wandel verwüstete Weltregionen oder Öko-Diktaturen, oder autoritäre wet dreams von rechts, oder Wohlfahrtsausschüsse, die freiwillige Entmündigung durch Wohlfühlszenarien belohnen, oder die Phantasien von Chat-GPT-verfassten Drehbüchern (»Kontrakt 23«), vielleicht hängt das alles ebenso mit dem Kino zusammen – und mit der neuesten Phase auf dem Weg zur Unsterblichkeit der Menschen, die der Film mit seinen unendlichen Geschichten der seriellen Universen beantwortet. Final Frontier war einmal.
Die Antworten und Reflexschemata von Rechts wie Links gleichen sich erstaunlich: Linke und Ökoaktivisten warmen vor dem Niedergang des bestehenden zivilisatorischen Status Quo; Rechte und bürgerliche Liberale warnen vor dem kulturellen Niedergang, beide Seiten betonen die Unausweichlichkeit, aktiv zu werden, zusammen mit der Unausweichlichkeit des Geschehenden; die Rechten wollen in der Sicherheits- und Einwanderungspolitik mehr Polizei und dafür die Klimapolitik
durch den Markt regeln lassen, die Linken wollen das Gleiche nur andersrum. Im Einen will man mehr Staat und Entmündigung, im anderen mehr Bürgerfreiheit.
Das Gemeinsame beider Positionen liegt in der Haltlosigkeit und Ratlosigkeit. Stichwort »Final Generation«.
Das Kino kann bei politischen Entscheidungen helfen, zugleich individualisiert es sie in seinen Szenarien aus Gründen dramaturgischer Zuspitzung und lässt dann nur die einzelnen Helden ein bisschen vom Weiterbestehen der gesamten Menschheit raunen. Wir befinden uns, so schreiben die beiden Autoren, »in einer Zeit der Dominanz des Endes, in der, bei allem zwanghaften Optimismus, die Erzählung von Niedergang bisweilen den Glauben an Fortschritt und Prosperität überschattet. ... Wie damit umgehen?« Keine Frage, dass das, ob Tatsachen oder nicht, wenig Raum für gute Laune lässt. Und manchmal ist die gute Laune wichtiger als die Achtung vor den Tatsachen.
Bei der Diagonale geht es dabei nicht ohne eine gewisse Nähe zu Abgrund, Doppelboden und Fatalismus, wir sind schließlich in Österreich. Der Handlungsstrang des Finales führt konsequenterweise auch in die Welt des Sports, in der es ja noch viel deutlicher als im Kino um emotionale Zuspitzung geht und um Spannung und um Euphorie nah am Fanatismus.
Jenseits vom Fußballplatz gibt es aber ebenfalls noch eine Welt. Und die Warnungen vor ihrem Finale »als alarmierender
Fluchtpunkt linker Jugendbewegungen haben ihre ideengeschichtlichen Vorläufer. All das sollte aber kein Grund zur zynischen Häme, sondern vielmehr ein Hinweis darauf sein, wie grundlegend ernst es Revoltierende mit den tatsächlichen, gefühlten und mitunter warenhaften Wahrheiten meinen.«
Wer die Gegenwart verstehen will, muss ins Kino gehen.