
ARTECHOCK

Texte
zum 13. internationalen Dokumentarfilm Festival MünchenPROGRAMM
 ARTECHOCK | |
 | Textezum 13. internationalen Dokumentarfilm Festival München |
| PROGRAMM |
 Vorwort: | Informationen der Festivalleitung |
 Grußworte: |
Christian Ude, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München Karl Griep, Leiter des Bundesarchivs - Filmarchivs, Berlin Horst J. Deinwallner, Leiter des Goethe-Instituts Mexiko |
 
|
Liebe Freunde des dokumentarischen Films, nicht zufällig eröffnet das Festival in einem Kino mit dem amerikanischen Film The Big One von Michael Moore. Das alles überragende und überschattende Problem unserer hochentwickelten industriellen Gesellschaften am Ausgang des 20. Jahrhunderts ist die Verknappung der Arbeit. Sie macht die Menschen arbeitslos, brotlos und - noch ernster - nutzlos und identitätslos. In seinem satirischen Dokumentarfilm Roger and me 1989 hatte Michael Moore erst in Amerika, dann auch in Europa mit seinen respektlosen Attacken auf den großen Boss seiner Heimatstadt Flint einen Kinohit lanciert. In The Big One macht er die Tour d’horizon durch mehr als fünfzig Städte und legt teilweise groteske Strukturen des amerikanischen „Beschäftigungswunders“ bloß. In gewohnt witzig-sarkastischer Weise führt er die Firmenchefs, die Pressesprecher, die PR Manager vor. Am liebsten - das sieht man - ergriffen sie die Flucht oder zertrümmerten die Kamera. Aber die Kamera läuft und läuft und sie dürfen sich keine Blöße geben: auch das eine Art SchauProzesse - ein vieldeutiger Begriff, der uns als Schlaglicht auf unser diesjähriges Programm nicht ungeeignet schien. Vor der Kamera werden - zuweilen - spektakuläre Dinge verhandelt: Dokumente und Zeitzeugen werden aufgeboten, es wird Anklage erhoben und dagegengehalten, es kommt zu leidenschaftlichen Plädoyers. Es werden Wertungen und Urteile gefällt. |
 Filme über Rand- und Ödland |
Auch im Zuschauer finden SchauProzesse statt. Film - wie Reiner
Werner Faßbinder einmal sinngemäß sagte, Film
befreie das Gehirn. Klärungsprozesse statt Ablenkungsmanöver,
Katharsis statt Zerstreuung. Auffällt, wie groß in diesem Jahr der Anteil an Filmen ist, die sich mit der Gesellschaft befassen, ihren Rändern und Nischen, ihren Outlaws und Freaks, mit denen, die immer zu kurz kommen und die eigentlich gar nicht zählen. Dies ist kein Jahrgang filmischer Rückerinnerung, geschichtlicher Aufarbeitung, der Spurensuche. Heuer geht es um schiere Gegenwart, und prall ist die Wirklichkeit nur, weil sie hart ist: Der Film Abstich hält die endgültige Schließung der thüringischen Maxhütte fest, Louta dokumentiert den Niedergang einer chilenischen Kohlemine, Lichter aus dem Hintergrund zeigt ein Berlin im rasanten Aufbruch, so gewaltsam, daß sich ein Teil seiner Bewohner, vor allem die aus dem Osten, nicht mehr zurechtfinden. So auch die Filme über gesellschaftliches Rand- und Ödland samt seinen Bewohnern: Auf der Kippe erzählt von den Roma im rumänischen Cluj, die an und von der Müllhalde vegetieren, Pelym von der fast vierhundertjährigen, besonders seit Stalins Zeiten berüchtigten Strafkolonie jenseits des Urals. In Public Housing geht Frederick Wiseman in gewohnt gründlicher Weise mit der Kamera einem sozialen Wohnungsprojekt auf den Grund, bis es sich - obwohl gut gemeint - als neue Version eines schwarzen Ghettos entpuppt. Münchner Freiheit erzählt vom Überleben und Sterben auf der Straße, Mama General, Dat geit los und der polnische Film Thirteen von Menschen, die - gesellschaftlich mehr oder weniger ausgegrenzt - sich ihren eigenen sozialen Mikrokosmus schaffen, in dem sich leben, überleben läßt. Boxen und sonst gar nichts und mehrere Kurzfilme empfinden das Lebensgefühl von jungen Kriminellen, Drogenabhängigen, Berbern, Straßenkindern und Behinderten nach. Manchmal ist es auch ein persönlicher Schicksalsschlag, der den Menschen aus der Bahn wirft. Sei es eine Sekunde Unachtsamtkeit, die aus ihrem Vater einen Grenzgänger zwischen Leben und Tod machte: so in Julia Loktevs Film Moment of Impact - er gewann den Regiepreis beim Sundance-Festival 1998 -, sei es die Krankheit zum Tode in Angel on my Shoulder, sei es die tiefe Depression in Demain et encore demain oder die Trauerarbeit in Malereien und Gravierungen und in Here today, gone tomorrow. In all diesen Filmen ist der Tod sehr präsent. Auch in Metamorphosen - drei Begegnungen mit dem Tod ist er zentrales Thema. Als ob das Tabu, das traditionell auf dem Tod liegt, auch im Dokumentarfilm - der ja mit diesem Tabu viel sensibler umgehen muß als der Spielfilm - schwächer würde... Reflexe von Tod, Gewalt und ihren Folgen auch in Killer Boots, Krieg und Terror in den Filmen Kisangani Diary und dem dreistündigen Film über die Nachkriegszeit in Bosnien Das Jahr nach Dayton, in dem israelischen Film Out for love ... Be Back Shortly: Im Brennpunkt das Dilemma der israelischen Jugend zwischen persönlichen Bedürfnissen und der politisch desolaten Situation voller Gewalttätigkeit. |
 Dokumenatarfilm als Seismograph |
Der Dokumentarfilm ist in vieler Hinsicht ein guter Seismograph:
Will man wissen, wie es zwischen Männern und Frauen, den
einzelnen Generationen, zwischen Menschen verschiedener sexueller
Vorlieben in einer Gesellschaft aussieht, liefert er genaue Indizien:
So in unserem Programm die Filme War Zone über die Anmache
auf Amerikas Straßen, Monika Treuts neustes Werk Didn’t
do it for Love und Peter Kerns hinreißender Film Knutschen
Kuscheln Jubilieren, der eine Gruppe schwuler Spießer in
ihre Stammkneipe und nach Venedig begleitet. Daneben der Publikumspreisgewinner
beim Sundance-Festival 1998, Out of the Past, Mond im Skorpion
und der Kurzfilm Du frißt und spuckst die Packung aus. Ein
Lieblingssujet des Dokumentarfilms bleiben die Künste und
ihre Protagonisten, aber auch das Kino selbst. So gibt es einen
Film über die Retrospektiven Reiner Werner Faßbinders
in Amerika, Life, Love and Celluloid, ein liebevoll-knappes Bildnis
des greisen Alexander Hammid in Aimless Walk und mit Ein ungeschliffener
Diamant das Portrait Dolores Fullers, Songschreiberin für
Elvis Presley und Lebensgefährtin Ed Woods. Auch Fotografen
und Maler sind geschätzte Sujets: Ara Güler, Chronist
Istanbuls über fünf Jahrzehnte in Ara, Robert Lebeck,
Stephan Moses und Thomas Höpker in Augenblicke, ein Ostberliner
Fotograf in Lichter aus dem Hintergrund, afrikanische Fotografie
in Future Remembrance u.a.. Unterschiedlicher und jeder in seiner
Art ausgefallener könnten die Film-Hommagen an die Dichter
und Künstler nicht sein: Disteln für die Droste von
Werner Fritsch und Vulkanmannen, ein experimentelles Portrait
des schwedischen Schriftstellers Sture Dahlström einerseits,
andererseits das fulminant schräge Film-Bildnis des amerikanischen
Enfant terribles Joe Coleman in R.I.P. - Rest in Pieces und der
Film Treffpunkt Abendstern, der einen Maler in Bozen vorstellt. |
 Geschichten aus unserem Jahrhundert |
Aus der unseligen Geschichte unseres Jahrhunderts sind noch immer
nicht alle Geschichten erzählt: Nicht die von der jüdischen
Großmutter, die schon in den dreißiger Jahren mit
Farbfilm ihr großbürgerliches Dresdener Ambiente filmte,
bevor sie emigrieren mußte, in A Letter without Words,
und auch nicht die von jener jüdischen Großmutter,
die - heute wäre sie 125 Jahre alt - schon als alte Frau
Hitlers KZs überlebte und dies Ende der vierziger Jahre
auf Tonband dokumentierte - in Theresienstadt sieht aus wie ein
Curort. Es gibt noch viel Unbekanntes zu erfahren von den finnischen
Juden in David - Stories of Honour and Shame, vom Todesmarsch
der Juden aus dem KZ Flossenbürg, von einer Mädchenschulklasse
in Ulm in Kinderland ist abgebrannt und in Engelen des Doods
vom Schicksal der Soldaten des sowjetischen Generals Vlasov,
der sie an die Deutschen verraten hatte. Eine Greisin erinnert
sich in Gesichterwahn daran, wie sie nach ihrem Schauprozeß
in Rumänien die jahrelange Einzelhaft überleben konnte,
ohne wahnsinnig zu werden. Vordringliche Aufgabe des Dokumentarfilms - so scheint es mir - ist es nicht, das Unverfälschte und Unverdorbene, das Originale, die Idylle festzuhalten. Nirgends sehe ich Idyllisches, überall nur beschwerte Gegenwart, die die Filmemacher wohl übers Bild in den Griff bekommen wollen. Auch scheint es nicht ihre Aufgabe zu sein, für eine „future Remembrance“, einen Vorrat für eine zukünftige Erinnerungsarbeit zu sorgen: Viel eher leisten sie Therapie, Katharsis aus verwirrenden und verworrenen Lebenssituationen und -stationen. Selbst die ethnographischen Filme Vision Man und Cracks in the Mask gehen weit über das bloße Festhalten hinaus: Sie analysieren kritisch das westlich- eurozentrische Verhalten zu anderen Kulturen. Auch Anak Kelana ist weit mehr als ein gut gemachter Abenteuerfilm: er charakterisiert das Verhältnis Europäer - Bewohner anderer Kontinente (hier Südostasien, Malaysia) auf ungewohnte Weise. |
 Asien |
Überhaupt ist der asiatische Raum in diesem Jahr gut vertreten: Der japanische Film Somaudo Monogatari erzählt eindringlich von Menschen, die fern ab in einem Waldgebiet wohnen; der japanische Fotograf Seiichi Motohashi hat mit Nahja no mura (Nadya’s Village) einen Film mit unvergeßlichen Bildern über die letzten Bewohner des verlassenen Gebiets um Tschernobyl gedreht. Die indischen Filme Kol Kathaen und Tusu Katha bringen uns Randzonen und ländliche Gebiete mit uralten Fruchtbarkeitsriten und ebenso archaischen politisch-sozialen Herrschaftstraditionen nahe. Als große Rarität zeigen wir drei Filme aus Kirgisien, einem Land, dessen Kinematographie heute ebenso brach liegt wie die anderer ehemaliger Sowjetrepubliken. Dennoch gibt es dort auch jetzt noch Filmemacher, die sich nicht entmutigen lassen und zu zeigen bereit sind, was noch vor kurzem an hochentwickelter dokumentarischer Filmkunst entstanden ist. Unsere Hoffnung ist es - wie auch mit unserer letztjährigen Retrospektive über die Produktion des St. Petersburger Dokumentarfilmstudios -, durch Kontaktvermittlung zumindest eine bescheidene Unterstützung dafür zu leisten, daß diese kinematographisch-künstlerische Tradition nicht gänzlich versiegt. |
 Afrika |
Afrika liegt den Dokumentaristen am Herzen: Der Film Kisangani
Diary legt ein erschütterndes Zeugnis ab über das Schicksal
der Hutu-Flüchtlinge im Kongo - ein Thema, über das
nach den gescheiterten Bemühungen der UNO um Aufklärung
der Massaker zurzeit in den Medien berichtet wird. In den Filmen Namibia - Rückkehr in ein neues Land, Future Remembrance, Khallil - Sohn der Sahara und Umm Kulthum - A Voice Like Egypt steht das Alltags- und kulturelle Leben verschiedener Regionen und Konfliktzonen des schwarzen Kontinents im Mittelpunkt. |
 Griechenland |
Als eine große Besonderheit können wir in diesem Jahr griechische Dokumentarfilme vorstellen. Neben Sinasos und Hercules, Achelous and my Granny zeigen wir zusammen mit dem Griechischen Filmforum München und der Griechischen Kinemathek Athen die Filmwerkschau Basil Maros, ergänzt von einer Fotoausstellung. Beide laufen auch in der Woche nach dem Festival weiter. |
 Special Screenings |
Auf einzelne Werke, die als Special Screenings im Programm figurieren,
möchte ich noch besonders hinweisen: Auf Wild Man Blues,
den neuen Film der zweimaligen Oscar-Preisträgerin Barbara
Kopple über einen - auch im Leben manchmal hinreißend
komischen - Woody Allen, der als Klarinettist mit seiner Band
durch Europa tingelt. In seinem sechsstündigen Werk Fragments * Jerusalem blättert der Israeli Ron Havilio einen prächtigen Bilderbogen über die Geschichte Jerusalems auf. Werner Nekes führt in seinem fünfstündigen Werk mit dem Titel Media Magica II die Vorgeschichte der Entstehung des Films anhand von optischen Geräten und Raritäten aus seiner riesigen Sammlung vor. |
 Lateinamerika |
Schwerpunktregion ist im diesjährigen Programm Lateinamerika:
Renommierte DokumentaristInnen aus Amerika und Europa schauen
auf diesen Kontinent: die Kanadierin Nettie Wild in A Place Called
Chiapas auf die politischen Ereignisse in diesem mexikanischen
Konfliktherd, Katherine Kean in Rezistans auf die Verstrickungen
der USA in die Politik Haïtis; in ...und plötzlich sahen
wir den Himmel vergleichen uruguayische und deutsche Filmemacherinnen
ihre Lebensgeschichten - ein wichtiges Stück Zeitgeschichte
politischer Kämpfe von Frauen aus Uruguay und Deutschland. Die aktuellen Lebensbedingungen auf Kuba, dem unsere Retrospektive gilt, schildern der Schweizer Film Ricardo, Miriam y Fidel und der deutsche Cinquillo Cubano, beide auf sehr lebendige Weise. Der brasilianische Film O Velho, eine Biographie von Luiz Carlos Prestes, den jahrzehntelangen Führer der Kommunistischen Partei Brasiliens, wurde erst jetzt nach dem Ende des Kalten Krieges möglich. Im retrospektiven Brennpunkt steht in
diesem Jahr der kubanische Dokumentarfilm: Wir stellen siebenundsechzig
Beiträge unter dem Titel Jenseits der Inselmythen vor. Sicher
weltweit einmalig in ihrem Umfang, war die Zusammenstellung dieser
Filmreihe mit nicht wenigen Schwierigkeiten verbunden. Sehr hilfreich
war als Mitveranstalter das Goethe-Institut, sowohl die Zentralverwaltung
in München als auch das Goethe-Institut in Mexiko in Zusammenarbeit
mit der Deutschen Botschaft in Kuba. Ebenfalls Mitveranstalter,
stellte das Bundesarchiv-Filmarchiv Berlin uns freundlicherweise
seine Kopien zur Verfügung. Folgende
Repräsentanten des kubanischen Dokumentarfilms sind zu Gast:
die Regisseure Octavio Cortázar und Pastor Vega von ICAIC und
UNEAC, der Regisseur Jorge Fuentes von TRIMAGEN und die Leiterin
der Abteilung „Internationale Beziehungen“ im ICAIC, Frau Maria
Padrón Iranzo. Ohne ihre professionelle Organisationsleistung
wäre die Retrospektive nicht zustande gekommen. Ich wünsche Ihnen rund ums Festival Erkenntnisse, Erlebnisse, Begegnungen der besonderen Art und dabei viel Vergnügen. Gudrun
Geyer, |
 GRUSSWORT Christian Ude Oberbürgermeister |
„Fragments * Jerusalem“ heißt ein Film im Festivalprogramm.
Er blättert in sechs kurzweiligen Stunden die Geschichte
Jerusalems anhand persönlicher, familienbezogener Dokumente
und historischen Archivmaterials wie in einem prächtigen
Bildband auf. „Out for Love ... Be Back Shortly“ heißt
ein weiterer Film, der die Situation junger Israeli zwischen
Krieg und Liebe, Terror und Privatheit sehr eindringlich auf
den filmischen Punkt bringt. So knüpft das Internationale Dokumentarfilmfestival an das Thema „Literatur aus Israel“ der diesjährigen Münchner Frühjahrsbuchwoche an und hält auf einem weiteren Gebiet die kulturellen Beziehungen und Kontakte zu Israel lebendig. Von besonderem Wert gerade für unsere Stadt ist die großanlegte Retrospektive „Jenseits der Inselmythen“ über den kubanischen Dokumentarfilm der letzten vier Jahrzehnte. Lebt doch hier eine große Bevölkerungsgruppe aus Lateinamerika, die den lebendigen Kontakt, die Übermittlung von Informationen und kulturellen Werten aus Kuba sehr wohl zu schätzen weiß. Christian
Ude |
 GRUSSWORT Horst J.
Deinwallner |
Im Namen des Goethe-Instituts gratuliere ich dem Internationalen
Dokumentarfilmfestival München ganz herzlich zu dieser Initiative,
kubanische Dokumentarfilme vorzustellen. Das Goethe-Institut Mexiko ist seit 1992 auch für die kulturelle Zusammenarbeit mit Kuba verantwortlich und konnte in diesen Jahren vor allem im Film- und Medienbereich zahlreiche Projekte in Havanna und in San Antonio de los Baños, dem Sitz der Filmhochschule, durchführen. Seit 1994 beteiligt sich das Goethe-Institut regelmäßig mit Retrospektiven deutscher Regisseure und mit Sonderveranstaltungen wie Stummfilm mit Piano am Festival des Lateinamerikanischen Films in Havanna. Mit dieser Initiative können wir nun auch einmal etwas für die Vorstellung kubanischer Filme in Deutschland tun, vor allem für den bisher weitgehend unbekannten Dokumentarfilm-Bereich. Ich wünsche dem Münchner Festival viel Erfolg und bedaure sehr, daß ich nicht selbst dabei sein kann. Horst J. Deinwallner |
 GRUSSWORT Karl Griep Leiter des Bundesarchivs - Filmarchivs, Berlin |
Mit der Veranstaltung einer Retrospektive verbindet sich bei
denjenigen, die die Veranstaltung vorbereiten und durchführen,
die Hoffnung, mit ihrer speziellen Filmauswahl bei den Zuschauern
auf Interesse zu stoßen und Anstöße zu geben.
Anstöße, die sich aus den Inhalten der Filme ergeben
können, insbesondere aber auch der Anstoß, die Techniken
und Methoden zu erkennen, mit denen die jeweiligen Filmemacher
gearbeitet haben. Das führt hin auf Kamerablickwinkel, Regiekonzepte,
Schnittechniken und vor allem auf die Filmsprache, auf die Art
und Weise, wie eine Idee filmisch umgesetzt wird, auf das Erzählerische
im Kino - das, was bei uns so starke, manchmal unauslöschliche
Eindrücke hinterläßt. Die s in einer Reihe von
Beispielen, oder besser an der Familie kubanischer Kinohandschriften
vorzuführen, ist ein Ziel dieser Retrospektive. Als das
Staatliche Filmarchiv der DDR im Jahr 1974 in Leipzig eine Retrospektive
zum kubanischen Dokumentarfilm veranstaltete, war deren Zielrichtung
sicher nicht von politischen Implikationen frei. Aber durch die
Auswahl der Filme, bei der Lektüre der begleitenden Texte
wird deutlich, daß das Interesse am kubanischen Dokumentarfilm
schon 1974 weit über die Stärkung des sozialistischen
Bewußtseins hinausging. Wenn das Bundesarchiv im Jahr 1998 gemeinsam mit der diplomatischen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in Kuba und dem Goethe Institut (ZV München und Goethe Institut Mexiko) eine Retrospektive zum kubanischen Dokumentarfilm unterstützt (einige der Filmkopien der Retrospektive stammen aus dem Bundesarchiv-Filmarchiv, die Mehrzahl kommt mit Hilfe der Botschaft direkt aus dem kubanischen Filmarchiv in Havanna), so ist doch offenkundig, daß hiermit keine politische Mission verbunden ist. Die Hoffnung, Anregungen geben zu können, verbinde ich mit den Konzepten des Filmemachens, die gerade aus der zeitlichen, räumlichen und gesellschaftlichen Distanz eine Rezeption erfahren können, die die künstlerische, historische und kommunikationswissenschaftliche Analyse erleichtert. Wenn dabei eine Akzeptanz für diese im besten Sinne einfachen, vielfach wunderbaren, kraftvollen Filmbilder entsteht und eigenes Filmesehen und Filmemachen neu erlebt wird, wäre außerordentlich viel gewonnen. Karl Griep |
 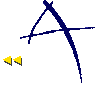 | PROGRAMM Filme in Münchner Kinos |
MAGAZIN Kritiken, Reportagen, Hintergründe | FORUM Ihre Beiträge, Diskussionen, Aktionen | INTERNET Links zu anderen Servern |