Rächerinnen der Gerechten – Erlöserinnen der Erlösten? |
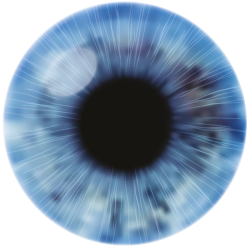 |
|
Tödliche Erlösung: Figuren der Rächerin im aktuellen Kino
Rache ist ein Anachronismus. Sie ist infantil und unanständig, bedient zutiefst archaische Triebe, gerade wenn es ums Rächen von Gewalttaten, die unendliche Reziprozität von Gewaltakt und Gegengewalt geht. Schließlich gibt es ja das Recht. Das soll für faktische Gerechtigkeit sorgen. Tatsächlich scheint die Rache – blutig, rücksichtslos, wahnhaft – auf den ersten Blick aus unserem kulturellen Repertoire verschwunden, zurückgedrängt von einem rechtlich geordneten Prozess. Doch lässt sich kaum sagen, die Rache sei wirklich verschwunden. Davon zeugen Ehrenmord und Revenge Porn, sogenannter »Handelskrieg« und diverse Bürgerkriege, sowie ein nicht enden wollender Strom popkultureller Ergüsse. Vom alten Rächer-der-Gerechten-Szenario scheinen wir einfach nicht genug kriegen können. Die Rache, in ihrer Rohform vom modernen Staat halbwegs gebändigt, fristet ihr Dasein in Nischen. Dort bedeutet Rache, sich über herrschendes Recht hinwegzusetzen, das Recht selbst in die Hand zu nehmen.
Woher dieser Hang zur Selbstjustiz? Sind Rache und Gewalt logische Konsequenzen der Kluft zwischen offiziellem Recht und empfundenem Unrecht?
Was sich immerhin feststellen lässt: Fantasien der Rache und der Selbstjustiz drängen sich auf. Als wäre der Hang dazu in unsere Großhirnrinde gemeißelt, als löste der Jähzorn in irgendeiner Weise alltägliche Probleme des Überlebens und der Reproduktion. Und doch existiert die Rache in Tagträumen weiter. Alleine im Dunklen, den stillen Wahnsinn in mir verbergend, bereite ich mich vor. Ich denke an Jigsaw, den Dauer-Antagonisten der Horrorfilmreihe Saw, der nicht müde wird seine normative Orientierung zu betonen: »Wir dürfen nie aus blinder Wut handeln oder aus Rachegefühlen.« Gerechtigkeit werde herrschen, und zwar, »weil wir für die Toten sprechen«. Menschen sehnen sich nach Genugtuung, nach Erlösung – in der Tat. Und verbleiben doch stets auf der Ebene der Fantasie.
Das Medium Film scheint in ganz besonderem Maße von der menschlichen Veranlagung zum Rachegelüst zu profitieren. Vom Superhelden-Epos über Rambo-Die-Hard-Action bis zum Revenge Porn kann es unterschiedlichste Formen annehmen. Zwei Dinge haben diese gemein: einen männlichen Protagonisten und den Anspruch, der Zuschauer solle stets nachvollziehen können, was vor sich geht. Aha, der rächt sich. Der wurde mal ungerecht behandelt. Ist aber eigentlich nicht gut.
Zwischentöne, Ambivalenzen und Dilemmata? Fehlanzeige. Wesentlich komplexer dagegen Aus dem Nichts und Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Beide Filme geben ihren weiblichen Hauptfiguren die Mittel der Selbstjustiz an die Hand und treiben sie damit in den Wahnsinn.
Wie jede filmische Rachefantasie wählen die Filme vom Schicksal gebeutelte Menschen. In Aus dem Nichts erliegen Ehemann und Sohn von Hauptfigur Katja einem rassistischen Terroranschlag. In Three Billboards verliert Mildred dagegen ihre Tochter durch einen brutalen und tödlichen Fall sexuellen Missbrauchs. Zwar ist die technische Herangehensweise unterschiedlich – ein Film kommt als naturalistisches Psycho-Politdrama daher, der andere als satirische Studie des Südstaatenmilieus – doch beide stellen Fragen der Gerechtigkeit und der Schuld in den Vordergrund. Wir beobachten zwei geschädigte Frauen auf ihrer Suche nach Genugtuung. Das klingt irgendwie vertraut – doch anstatt Uma Thurman oder Jigsaw dabei zuzusehen, wie sie das Ausmaß ihrer Gnade in abgetrennten Körperteilen bemessen (Spoiler: Gnade = Null), hat man sich hier eher mit der Frage befasst, ob es so etwas wie Gerechtigkeit überhaupt geben kann. Als komplexe Rachefantasien zeigen sie, worum es wirklich geht. Das ist nämlich keineswegs das Recht auf Selbstjustiz. Denn was die beiden Filme ausmacht und trotz allem nachvollziehbar werden lässt, ist nicht ihr Festhalten an einer unbedingten Moral, sondern ihr Porträt der Rache als Prozess des Loslassens und der Erlösung.
Jemand hat Katjas Sohn und Ehemann an dessen Arbeitsplatz in die Luft gesprengt. Zunächst geht die Polizei davon aus, dass Verstrickungen ihres Mannes in die migrantische Unterwelt dafür verantwortlich sind. Katja jedoch bestreitet dies vehement. Sie gibt an, die mutmaßliche Täterin vormittags am Tatort beobachtet zu haben und vertritt eine alternative These: Katja glaubt an eine rechtsextremistisch motivierte Tat. Doch in der Welt des leitenden Kriminalbeamten ist das unvorstellbar. Als ihr niemand glauben schenken mag, beschließt sie sich umzubringen. Schon mit aufgeschlitzten Pulsadern in der Badewanne liegend, erfährt sie jedoch von ihrem Anwalt auf dem Anrufbeantworter, dass »zwei Nazis« festgenommen worden sind. Ein Streifen Hoffnung, die Szene endet, wir befinden uns vor Gericht. Katja und ihr Anwalt Danilo sitzen zwei Menschen gegenüber, jung und verheiratet. Den leeren Blick starr geradeaus gerichtet und leicht zurückgelehnt posieren diese Nazi-Köpfe mit ihren Nazi-Schuhen und Nazi-Jacken. Ein waschechtes Rassisten-Paar also. NSU-Skandal lässt grüßen. Kurz nachdem sich diese für den Film entscheidende Konstellation eingebrannt hat, kommt es zum Eklat: Eine Gerichtsmedizinerin berichtet von den Folgen der Bombenexplosion auf die Körper der Opfer. Es ist eine nicht enden wollende Aufzählung von verbranntem und zerfetztem Fleisch, nüchtern und teilnahmslos im Ton. Katja bittet darum, den Saal verlassen zu können. Es ist unklar, ob es die blutigen Details sind oder die betonte Gleichgültigkeit, die dem Auftritt der Medizinerin innewohnt, die Katja dazu veranlasst hat. Kurz darauf fällt Katja über die mutmaßliche Täterin her, jene junge Frau, die sie ursprünglich am Tatort beobachtet hatte. Wochen vergehen und das Verfahren wird mangels Beweisen eingestellt. Daraufhin reist Katja nach Griechenland. Danilo drängt auf eine Revision, weist mit staatstragendem Pathos darauf hin, dass »wir diese Bastarde kriegen, das schwör' ich dir!«, und wirkt doch insgesamt weniger an Katja interessiert als an dem, was der Prozess seines Lebens werden könnte. Am Ende sprengt sich Katja gemeinsam mit den Tätern und mit einer selbstgebastelten Nagelbombe um den Bauch in die Luft.
Die lange Szene vor Gericht lässt tief blicken ins Innenleben des Films und das seiner Protagonistin. Wir sehen Trauer in Wut umschlagen. Bezeichnenderweise passiert das genau in jenem Moment, in dem sich Katjas Entfremdung von der richtenden Instanz (in Form des Vortrags der Medizinerin) anbahnt – eine Entfremdung, die mit dem Einstellen des Verfahrens aufgrund der Beweislage vollkommen wird. Regisseur Fatih Akin: »Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten würde, verlöre ich Frau und Kind.« Ohnmächtig vor der Arroganz der Herrschenden wird Katja nichts anderes übrig bleiben, als selbst zur Tat zu schreiten, die Schuldigen zu bestrafen, kurz: zu retten, was es noch zu retten gibt.
»Das Recht der Menschen, selbst für sich zu sorgen, auch wenn das Gesetz es nicht tut, ist unangreifbar«, so ein Professor Bigger bei einem Vortrag irgendwo im Süden der USA anno 1867. Und auch wenn Besagter damit wohl keine Selbstmordattentate auf Rassisten gemeint hat, so ist diese Ansicht doch bezeichnend für den in der US-amerikanischen Kultur sehr stark ausgeprägten Hang zur Selbstjustiz. Three Billboards behandelt diesen Sachverhalt aus Perspektive der starrsinnigen Mildred Hayes, die durch ihren Versuch, die eingefrorenen Ermittlungen im Mordfall ihrer Tochter wieder in Gang zu bringen, zu eigenwilligen Mitteln greift: Mildred lässt Werbetafeln aufstellen, auf denen sie den lokalen Polizeichef dazu auffordert, endlich jemanden für die Tat zu belangen. Die Logik dahinter ist so dumm nicht. »Je mehr Raum ein Fall in der Öffentlichkeit einnimmt«, sagt sie einmal, »desto größer die Chance, dass er aufgeklärt wird.« Und tatsächlich gelingt es ihr mithilfe dieser ungewöhnlichen Taktik, die ganze Stadt aufzuscheuchen. Schon meldet sich Chief Woody – im steifen Hemd und pechschwarzen Sheriffhut eine makellose Verkörperung des rechtschaffenen, liberalen (und weißen) Amerikas – bei ihr. Er versichert, es tue ihm ja leid, dass man den Verantwortlichen nicht geschnappt habe, aber die lokalen Behörden hätten schließlich alles gegeben. Es gebe niemanden in der nationalen Vorstrafendatenbank, der mit der DNA-Spur am Tatort übereinstimme. Mildred entgegnet trocken, an seiner Stelle würde sie dem ganzen Land DNA-Proben abnehmen lassen. »Ich glaube, es gibt Bürgerrechtsgesetze, die das verhindern«, antwortet Woody. Ohne sich davon beirren zu lassen, spricht Mildred weiter. An seiner Stelle würde sie den Täter finden und ihn zur Strecke bringen. Dagegen spräche allerdings ganz sicher ein Bürgerrechtsgesetz, so der Sheriff.
Das Nichtverständnis der Gekränkten für Woodys Verweis auf Bürgerrechte und „due process“ erinnert an die Irritation diverser Law-and-Order-Politiker, dass Menschen hierzulande tatsächlich Rechte besitzen, auch wenn sie Unrechtes getan haben (wir denken ans neue bayerische Polizeigesetz). Der Gerechtigkeitssinn der Menschen hat eben gerne einen Schuldigen. »Von der „Geierwally“ bis zum Hamburger Hafenkrimi dreht sich ein unendlicher, wirrer, unauflöslicher Zirkus von Bildern über Schuld, Verantwortung, Leiden, Bedeutung«, schreibt der Bundesrichter Thomas Fischer. Hinzu komme der Medienrummel um immer neue „Sauereien“ und die Überforderung der Sicherheitskräfte. So etwas verstärkt natürlich das Unbehagen am Staat und fördert die Tendenz, das öffentliche Tragen von Schusswaffen als Tugend anzusehen. Bürgerwehren, die das Recht einfordern, es selbst in die Hand zu nehmen, sind eine Art ohnmächtiger Racheakt. Heinrich von Kleist berichtet, sein Michael Kohlhaas – dessen Rechtsgefühl übrigens »einer Goldwaage glich« – habe sich im Akt der Selbstjustiz von doppelten Motiven leiten lassen. Er sehnt sich nach »Genugtuung für die erlittene Kränkung, und Sicherheit für zukünftige seinen Mitbürgern zu verschaffen.« Es ist also aus Rache und Berufung, dass Kohlhaas einen Kleinkrieg vom Zaun bricht.
In allen beschriebenen Narrativen gilt: Recht und die Sehnsucht nach Gerechtigkeit kommen auf keinen grünen Zweig. Sie suggerieren, dass in solch verfahrenen Situationen eine Vermittlung zwischen BürgerInnen und herrschender Ordnung kaum mehr möglich ist. Beiden Filmen ist eigen, dass sie die „starken“ moralischen Männerfiguren – der Sheriff, Katjas Anwalt (in Kleists Fall gar einen Martin Luther) – beim Versuch scheitern lassen, vernünftiges Recht mit emotionaler Gerechtigkeit zu vereinen. Was bleibt, ist nicht einmal mehr der Ruf nach Gerechtigkeit, sondern der nach nackter Schuld.
In beiden Filmen, und das ist das Perfide-Naturalistische an ihnen, richtet sich die Frage nach der Schuld immer schon nach innen. In ihrer hoffnungslosen Suche nach „Gerechtigkeit“ fallen die beiden Protagonistinnen stets auf sich selbst zurück. Indem sie sich die Schuld an ihrem Elend geben (Katja hätte die Nazi-Terroristin vorher aufhalten können, Mildred hätte ihrer Tochter bei ihrem letzten Gespräch nicht wünschen sollen, sie möge auf dem Weg zur Party vergewaltigt werden), rächen sie sich in Wirklichkeit an sich selbst. Stets müssen sie ihr Handeln vor sich rechtfertigen, denn sie stehen vor der ewigen Frage: Warum lebe ich und nicht du? Im Falle dieser beiden vom Schicksal getroffenen Frauen bedeutet der Rachefeldzug also immer auch das Infragestellen der eigenen Daseinsberechtigung. Nicht in der Lage, diese Hölle zu ertragen, flüchten sie sich in einen Handlungsdrang, dessen einzig möglicher Ausgang sich in der – meist tödlichen – Erlösung findet.