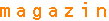| magazin |

visuelle labyrinthe
neue bildmedien -
kunsthistorische positionen
museumsbus
fährt an der kunst
vorbei
objektiv gesehen
die photographie
und ihre orte heute
|
|
Doch ob Photographie nun Kunst sei - darin ist man sich auf der Tagung der Evangelischen Akademie in Tutzing (12.-14.Dezember 1997) einig - das ist die falsche Frage! Erstens wandelt sich der Kunstbegriff unaufhörlich. Zweitens fällt es gerade heute angesichts der medialen Bilderflut schwer, von bildender Kunst als einem vom Alltag isolierten Phänomen zu sprechen.
Der „Kunstbegriff“ muß erweitert werden. Ebenso die Kunstwissenschaft. Die Frage, die die Organisatoren der Tagung Anne-Marie Bonnet, Professorin für Mittlere und Neuere Kunstgeschichte an der Universität, Bonn, und Professor Hubertus von Amelunxen, Literatur- und Medienwissenschaftler an der Muthesius-Hochschule in Kiel, zuförderst stellen, ist, was wir mit der Photographie machen, was wir von den Bildern wollen.
|
|
|
|
Viktor Burgin, Photograph und Professor
des History of Consciousness Department an der University of
California, Santa Cruz, stellt in Tutzing sein erstes Künstlervideo
vor. In „Venise“ (1993) geht es auch um Orte, um San Francisco,
Paris, Marseille. Aber es geht nicht um real existierende Orte,
es geht um Ortsmythen, um die allgemein erinnerten Geschichten
einer Stadt und um die persönlichen Erinnerungen. Erinnert
wird an Hitchcocks Film „Vertigo“, der in San Francisco spielt,
erinnert wird auch an die Romanvorlage mit den Schauplätzen
Paris und Marseille. „Vertigo“ erzählt von der Bürde
der Vergangenheit und der Erinnerungen. Das Video selbst ist
eine Aneinanderreihung von Zitaten: Hitchcocks Film und seine
Vorlage, wortreiche Gedankenzitate zum Thema Erinnerung.
Burgins
theoretischer Beitrag befaßt sich auch nicht mit herkömmlicher
Photographie, sondern mit der Internet-Arbeit einer jungen Amerikanerin.
Jennifer Ringley speist
mittels einer Kamera Bilder ihres Schlafzimmers (alle drei Minuten
eins) ins Internet. Der Betrachter nimmt auch hier nicht den
realen Ort, "Jenny's Room", wahr, sondern lediglich eine Folge
von Video-Stills und wird somit zum Voyeur, indem er seine eigenen
Wünsche und Erwartungen in das Bild projeziert - oder ist
sie eine Exhibitionistin?
|
|
Gibt es eine Authentizität? Die Frage kehrt immer wieder zurück, obwohl sie regressiv ist, obwohl wir es doch längst besser wissen sollten, daß es nichts Authentisches gibt. "Die höchste Fiktion ist die, der Fiktion entkommen zu können"(Amelunxen). In einer Zeit, in der die Welt immer mehr hinter Bildern verschwindet, „entwirklicht“ wird, erfährt der Betrachter vor der „künstlerischen Photographie“, die eigenen Zweifel an einer Welt zwischen Sein und Schein.
Die Auslotung neuer Realitäten zwischen real und irreal erfordert also neue Medien, solche die uns zweifeln lassen, nicht zuletzt an uns selbst. „Zweifel als konstruktive Kraft“ (Bonnet)- vielleicht ein neues Kriterium für Kunst?
Imke Bösch mit Christian Schoen
|
|
15. Januar 1998
Bilder und clichés - Kunst und Neue
Medien - à propos Photographie
Prof. Dr. Anne-Marie
Bonnet, Kunsthistorisches Institut Bonn
22. Januar 1998
Jenseits
der Euphorie. Was vom Mythos Video bleibt
Dr. Friedemann
Malsch, Staatliche Kunstsammlung Liechtenstein
29. Januar
1998
Die neuen Medien - museumsreif?
Prof. Dr.
Hans-Peter Schwarz, Zentrum für Kunst und Medientechnologie
Karlsruhe
5. Februar 1998
Das Museum als kollektives
Gedächtnis
Dr. Jean-Christophe Ammann, Museum
für Moderne Kunst Frankfurt
12. Februar 1998
Alte
Methoden für Neue Medien? Fragen an die Inhalte der 'Zukunftsperspektive'
im Fach
Prof. Dr. Hans Belting, Hochschule für
Gestaltung Karlsruhe
19. Februar 1998
Kunst als Kritik
des Sehens? - Bemerkungen zu Problemen einer Medientheorie der
bildenden Künste
Prof. Dr. Hans Ulrich Reck, Hochschule
für Medien Köln
26. Februar 1998
Die mediale
Ästhetik der Kunstgeschichte. Ein Diapositivvortrag
Prof.
Dr. Beat Wyss, Kunsthistorische Institut Stuttgart
mit
anschließender Podiumsdiskussion:
Standortbestimmung
und Zukunftsperspektive des Fachs Kunstgeschichte
voraussichtlich
mit Beat Wyss, Anne-Marie Bonnet, Walter Grasskamp, Rainer
Crone, Willibald Sauerländer Moderation: Hubertus
Gaßner
Beginn: 18 Uhr
Ort: Hauptgebäude
der LMU, Hörsaal 201

|
|

Ein Bus, der von Museum zu Museum fährt. Er beginnt am Nordbad, dort gibt es zwar kein Museum, aber nach nur acht Haltestellen erreicht man bereits das erste Haus dieser Kategorie. Zugegebnermaßen trifft diese Haltestelle Schellingstraße natürlich nicht ganz genau ins Schwarze, aber immerhin kann man sich von dort aus aussuchen, wohin man zu Fuß weiter gehen möchte: zu den Pinakotheken oder gar zum Lenbachhaus? Daß weder die eine noch die andere Institution auch bloß in Sichtweite zum Busstop liegt, kann für den Touristen kein Problem werden, wo man doch in dieser Stadt quasi alle Naslang auf Kunst stößt. Außerdem können die Touris ja auch in die „Museumsstraßenbahnlinie“ 27 einsteigen.
Die nächsten drei Haltestellen können wiederum keine Museen bieten - aber wozu denn auch, schließlich wird der Passagier gewissermaßen für umsonst die Münchner Prachtstraße, die Ludwigsstraße, bis zum Odeonsplatz hinaufgefahren. Odeonsplatz ist dann die Station, die für das Deutsche Theatermuseum, die Staatliche Sammlung Ägyptischer Kunst, die Schatzkammer der Residenz, das Siemens-Forum und die Staatliche Münzsammlung empfohlen wird. Aber Vorsicht: Die Residenz verfügt doch über die „Residenz-Straßenbahnlinie“ 19! Und sind dann die U3, U4, U5 und U6 nicht auch irgendwie „Museums-Ubahnlinien“? Herumirren nach voreiligen Busausstieg wird auf jeden Fall dadurch gewährleistet, daß sich an der Museumsbushaltestelle keinerlei Wegweiser in Richtung der manigfaltigen Kunststätten befinden.
Bleibt der geduldige Tourist noch ein bißchen sitzen, dann fährt auf ihn aber tatsächlich eine Museenflut ein: zwei Haltestellen weiter folgt das BNM, die Neue Sammlung, das Haus der Kunst, die Prähistorische Staatssammlung, die Staatsgalerie, eins weiter die Schack-Galerie und noch ein Halt später die Villa Stuck. Hier gibt’s wirklich nichts zu meckern, die Tempel der Kunst grenzen genau an die Haltestelle an.
Abgerundet wird das Angebot durch vier abschließende Stationen ohne Kunst bzw. eigentlich schon mit kunsthaltigen Möglichkeiten, auf die aber nicht hingewiesen wird. Der Kunstbunker Tumulka am Prinzregentenplatz kann ja auch nicht mit solch altehrwürdigen Einrichtungen wie dem Siemensforum mithalten.
Die Intention, in München mehr Orientierung zu schaffen, hat ein Lob verdient. Schon lang bestehende Buslinien flux umzubenennen, würde der Böswillige aber gern als Etikettenschwindel bezeichnen.
Einzelheiten entnehme
man der Broschüre des Münchner Verkehrs- und Tarifverbund
GmbH

|
|
Florenz und die Toskana, Schack-Galerie
besprechung von milena greif
art from the uk
Teil I, Sammlung Goetz
besprechung von susanna ott
blütenblätter an der hand
Ellsworth Kelly - Retrospektive, Haus der Kunst
besprechung
von barbara rollmann
bestechende
kleinteiligkeit
Kleine Formate, Artothek
besprechung
von milena greif

|
empfehlungen |
Was Sie keinenfalls versäumen sollten!

|
|