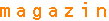|
1 2 1
2 6 0 1 2 0 0 0
|
besprechung
viola tricolor - fotografien von klaus oberer |
klaus oberer - viola tricolor
11 fotobilder aus der quadratischen serie, viola tricolor, 1996
10 fotobilder aus der rechteckigen serie
viola tricolor, 1996
eine ausstellung in der galerie
wolfgang tumulka
von 26.01.2000 bis 25.02.2000 |
|
Die Fotografie vermag es, die einfachen Dinge des Lebens
in ihrer Schönheit wiederzuentdecken und so zu erretten, so schrieb
dereinst Siegfried Kracauer über das neue Bildmedium. Schön sind die
Fotos von Klaus Oberer, die derzeit in der Galerie von Wolfgang Tumulka
zu sehen sind.
Es sind Pflanzen, Blüten und Blätter, die Klaus Oberer als Motive seiner
fotografischen Bilder wählt. Eine Blume steht im Zentrum der Bilderserie,
die in der Ausstellung gezeigt wird. Es ist die Viola tricolor, eine
Pflanze die in den unterschiedlichsten Ländern verschiedenste, phantasievolle
Namen trägt: das Spanische und Französische kennt sie unter dem Namen
„pensamiento“ bzw. „pensée“, Gedanke und auch im Italienischen wird
sie „Viola del pensiero“ genannt. Das polnische und ukrainische „bradkie“
(bzw. „bratky“) nennt sie Geschwister und weiß dazu eine Sage zu erzählen:
Und zwar heiratete ein junges Paar, ohne zu wissen, dass sie Geschwister
waren. Als die beiden ihr unfreiwilliges Verbrechen erkannten, hatte
sie solchen Kummer, dass sich Gott ihrer erbarmte und sie in die Blume
verwandelte. Schon seit dem 16. Jahrhundert heißt diese Pflanze im deutschsprachigen
Raum „Stiefmütterchen“. Man könnte auch hier eine Geschichte oder ein
Märchen hinter der Namensgebung vermuten. Der Name wird jedoch eher
nüchtern botanisch gedeutet: Fünf schlanke grüne Kelchblätter tragen
die fünf bunten Blütenblätter. Das unterste breite, stark gefärbte Blütenblatt
sitzt auf zwei Kelchblättern - es ist die Stiefmutter. Rechts und links
von ihr, ebenfalls bunt gekleidet, ihre zwei richtigen Töchter auf je
einem Kelchblatt. Die beiden oberen Blüttenblätter sind die Stieftöchter;
sie müssen sich mit einem Kelchblatt gemeinsam begnügen. Die Kunstgeschichte
kennt das Stiefmütterchen spätestens seit der Frührenaissance als Symbol
für das Leiden Christi und als Zeichen der Trinität. |
| |
|
|
ein
stiefmütterchen durch den blick der kamera
|
|
Wie nähert sich Klaus Oberer dieser Blume, die also christlich-symbolisch
befrachtet ist und der seit der Romantik fast etwas liebliches, fast
sogar biederes anzuhaften scheint?
Zu allererst bleibt festzuhalten, dass der Blick der Kamera sich auf
die Blüte selbst konzentriert, also nicht aus einer botanisch-objektiven
Warte die Pflanze in Gänze widergeben will. Die Bilder sind dabei
durch und durch komponiert: Mal ruhen sie in sich, mal sind sie rhythmisch,
mal explosiv. Vielerlei Formen- und Farbakzente gestalten die Bildoberfläche
zu einer harmonischen oder spannungsvollen Komposition. Es war allerdings
nicht der Pinsel des Malers, der diese Bilder entstehen ließ. Es war
der “Stift der Natur”, der Pencil of Nature, wie Henry Fox Talbot
- einer der Väter der Fotografie Mitte des 19. Jahrhunderts - die
neue Technik genannt hatte. Hier offenbart sich die Dualität des künstlerischen
Konzepts von Klaus Oberer: einerseits zu fotografieren, d.h. kühl,
distanziert zu dokumentieren, andererseits Bilder zu gestalten, d.h.
künstlerisch-kreativ und somit subjektiv und ‘malerisch’ zu sein.
Die Fotografie, die sich normalerweise bemüht, das darzustellende
Objekt möglichst scharf und mit seinen charakteristischen Eigenschaften
abzubilden, löst bei Oberer die einzelne Blüte aus ihrem biologischen
Kontext heraus. Zu sehen sind nicht die Konturen, d.h. die Form der
Blüte, die ihre Klassifizierung bestimmt. Die Kamera, das Auge kriecht
förmlich in die Struktur der Natur hinein.
|
 
|
Bereits das Sammeln der Blüten erfolgt durch eine Auswahl nach bestimmten
ästhetischen Kriterien. Schon zu diesem Zeitpunkt verwandelt sich
das Blatt im Auge des Künstlers erstmals in ein Bild. Der Blick antizipiert
die Kleinbildkamera, die eine Fläche in dem Blatt aufnimmt. Das Aussortieren
kommt dem Versuch gleich, im Chaos der Natur gewisse Gesetzmäßigkeiten
zu finden. Diese Gesetzmäßigkeiten werden von Klaus Oberer jedoch
nicht in der botanischen Klassifizierung gefunden, sondern - paradoxerweise
- im Dokumentieren der Unendlichkeiten der Formen und Farben, der
Geometrien und Strukturen - also des Prinzips Chaos. Das ordnende
Prinzip der Fotografie verbindet sich hier mit dem natürlich-chaotischen
der Natur.
Zur Verdeutlichung kann man sich die Fotografien von Karl Bloßfeld
zum Vergleich vornehmen. Bloßfeld nahm in den 20er Jahren - einer
Zeit in der um die Erscheinung der abstrakten Kunst gestritten wurde
- mit seinen Fotografien von Pflanzen vehement zu dieser Diskussion
Stellung. Er wollte deutlich machen, dass die Kunst in ihrer Abkehr
von der Schönheit und der Erhabenheit der Natur ihre Seele verloren
habe. Seine gestochen scharfen Fotos lassen den Gegenstand der Natur
wie ein Konstrukt der Kunst (aus Architektur oder Skulptur) erscheinen,
wobei das Gegenteil gemeint ist: Die Natur sollte Maßstab für die
Kunst sein. Bei Bloßfeld wirkt die Natur geordnet, architektonisch
und ornamental. Der augenfälligste Unterschied der Aufnahmen Oberers
zu denen Bloßfeldts liegt auf der Hand: Bloßfelds Fotos sind mit einer
gestalterischen Konsequenz gemacht, die sie zu Inkunabeln einer unpersönlich-neutralen
Fotokunst machen, ohne jede literarische Aufladung oder theatralisch-mystische
Inszenierung des Sujets und das nicht nur, weil es sich um Schwarz-weiß-Fotografie
handelt. Grund für diese kühle Strenge ist vor allem das Herausreissen
des Gegenstandes aus seinem natürlichen Umfeld und seine Isolation
im Bild. Klaus Oberers Fotografien sind anders. In seinen Bildern
ist das Blatt oder die Blüte nicht Isoliert - sie ist vielmehr das
Bild. Naturkosmos und Bildkosmos verschmelzen miteinander.
Seine Fotografie ist eine reine: Sie begnügt sich damit, das ausgesuchte
Motiv abzulichten, ohne digitale Manipulation, nur mit den rein fotografischen
Gestaltungsmitteln Licht, Schärfe und Ausschnitt. Obwohl Klaus Oberer
auch große Bildformate wählt, benutzt er mit Absicht die Kleinbildkamera,
nimmt somit eine gröbere Bildauflösung und Körnigkeit in Kauf. Und
dennoch: keine Blüte gleicht der anderen. Ja bei manchen mag man gar
vergessen, dass es sich um eine Pflanze handelt und man beginnt zu
assoziieren. So mag der helle Mittelpunkt der einen zum mystisch beleuchteten
Akteur auf einer Theaterbühne werden; eine andere erinnert wiederum
an den Tanz der Loie Fuller (Anfang des 20. Jh.) mit ihren weiten,
fliegenden Gewändern. Wieder andere werden bestimmt von einer recht
prallen Erotik oder einer fast strenge Religiösität. Dabei steht das
schöne Bild im Zentrum von Oberers Interesse, ein Bild auf dem das
Auge sich tastend aufmacht, die Formen und Farben der Natur zu erkunden.
Dabei darf sich das Auge auch durchaus den Luxus erlauben, an einem
Fleck eine Weile auszuruhen.
christian schoen
|
|


|

kunst in münchen
suche |
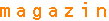
berichte, kommentare,
archiv |

meinungen,
thesen, aktionen |

kulturinformation
im internet |
|