  |
289 10|03|2003 | besprechung lichtphänomene und wahrnehmungstheorien im kunstbau |
 |
Tief unten im Unterbau des U-Bahn-Netzes, wo sonst schummrige Neonlichter Mitreisende zu Täter werden lassen, hat Olafur Eliasson Licht ins Dunkel gebracht. In der eigens für den Kunstbau konzipierten Arbeit „Sonne statt Regen„ projizieren computergesteuerte Chips die Spektralfarben des Regenbogens auf eine sich über die gesamte Länge des Kunstbaus (110 Meter!) erstreckende Leinwand. Langsam wandert Farbton für Farbton von den Seiten her über die Projektionsfläche, sie verändern ihre Intensität, ihre Farbtemperatur. Steht man vor einem Bildsegment der Lichtmembran, entsteht ein immaterielles Farbkissen, das formal an Rothko, Turrell oder Geiger erinnert. Als Tafelbild lässt sich die Lichtinstallation dennoch nicht genießen, auch wenn so mancher Besucher die gesamte Projektionsfläche auf der Suche nach dem richtigen Betrachtungsabstand abschreiten wird. |
|
 |
Nah oder fern, kritische Distanz oder emphatisches Aufgehen, wie
nähert man sich Elissons Installation? Zumindest einige Zeit ist von
Nöten, um sich in die Dramaturgie des Lichtspektakels einzufühlen.
Farben leuchten aus dem Dunkel herauf und verändern die Stimmung des
Raumes. Nutzt man eine der Sitzgelegenheiten im Kunstbau, fühlt man
sich bei manchen Rottönen an einen romantischen Abend im Urlaub erinnert-
oder genießt wie im Zeitraffer die Wärme des Lichts nach langen Wintermonaten.
|
|
 |
Romantisches Naturerlebnis im Kunstbau? Physikalische Lichtphänomene bringen Natur durch eine kulturelle Inszenierung wieder? Als gefundenes Fressen für diese Deutung mag die Tatsache dienen, dass der Künstler darüber hinaus aus einem Land stammt, das schlechthin für Naturerlebnis steht- aus Island. Doch Vorsicht- neben aller Hingabe an das überwältigende Ereignis Licht, dass Gefühle subtil steuert und beeinflußt, geht es in dieser Ausstellung nicht um ein Abbild der Natur. Und auch nicht um die abgenuschelte Medienkritik, dass man reine Natur heute nicht mehr empfinden könne, da sie als Zitat aus Film und Bild erscheine, über die Medien ohnehin viel geläufiger weil auch leichter konsumierbar sei. | |
 |
Worum geht es dem in Berlin ansässigen Naturromantiker? Eliassons Installationen zeichnen sich auch neben den zum Thema genommen physikalischen Naturphänomenen auch immer durch eine kühle Technik aus, bei den ersten Arbeiten durch einfache, schlichte Mittel, siehe „ ice pavillon„ – Stahl, Wasser Sprinkler. Im Kunstbau werden die gestaltenden Mittel äußerst komplex, dennoch bricht sich die Illusion technischer Perfektion. Die Leinwand ist ihrer Materialität enthoben, auch optisch als Fläche nicht mehr faßbar, gleichzeitig ahnt man ihr Skelett, die Konstruktion der Neonleuchten hinter der Membran- die Nähte der aneinandergereihten Leinwandstücke bremsen den Blick vor einem Fall ins Unendliche. | |
 |
Bei aller Ergriffenheit, der man sich beim Betrachten der Arbeit nicht entziehen kann, macht der Künstler die Deutung der Arbeiten nicht leicht. Neben dem Zitat von romantischer Landschaftsmalerei beinhaltet Eliassons Installation eine kalkulierte rationale Kühlheit, parallel zur Manipulation der Gefühlslage des Besuchers durch Lichtstimmungen geht es ganz wissenschaftlich um die Wahrnehmungstheorie. Hierfür schafft der Künstler ein abstraktes Modell. | |
 |
Eine eigenständige schöpferische Energie spricht er dem Betrachter zu, einen aktiven Dialog der Auseinandersetzung, denn das Auge des Betrachters reagiert mit der Komplementärfarbe auf die Farbstimmung des Raumes. Verändert sich nun wiederum die Raumfarbe, hinkt der Wahrnehmungsprozess des Auges hinterher und der Betrachter sieht eine dritte, ganz eigene Farbe. Für Olafur Eliasson rezipiert der Betrachter nicht ungefiltert Dargebotenes, sondern besitzt einen inneren Widerstand, lässt sich nicht ohne weiters überwältigen. Ein intellektuelles Hintertürchen also, und Bernhard Schwenk sieht es so, dass Eliasson Naturerfahrung über ein Medium erst wieder erfahrbar macht. | |
 |
Ein bißchen erscheint es hier, wie wenn sich ein theoretischer Diskurs verselbstständigt hat, das Sekundär- das Primärerlebnis ablösen solle, weil sich die Wahrnehmungssinne einer Kultur verändert haben. Über dialogisches Verhältnis von Werk und Rezipient lässt sich streiten, negieren doch nicht steuerbare Wahrnehmungsprozesse den Anspruch einer suggerierten Interaktivität. | |
| Eliasson sensibilisiert nicht unsere Wahrnehmung für Naturereignisse, sondern unser Empfinden für Zivilisation, indem er – ohne sie zu lösen- Fragen aufwirft über das Verhältnis einer Erfahrung zu ihrem Rezipienten. Gibt es denn überhaupt noch eine Unterscheidung in originale oder nicht-originale Erfahrung? Die Installation im Kunstbau hinterläßt einige ungelöste Bereiche- das kann man durchaus als interaktiven Part sehen. | ||
 |
Eliasson sagt von sich, er äußere sich selten direkt, als ihn eine
Journalistin über sein Verhältnis zur Politik befragt- der Titel „Sonne
statt Regen„ bezieht sich auf den Song „Sonne statt Reagan„ von Josef
Beuys, mit dem sich dieser 1982 für die Grünen engagierte und sich
gegen die Aufrüstungspolitik der USA wandte. Die Kuratorin der Ausstellung,
Susanne Gaensheimer, verweist darauf, dass sich diese Bezugnahme als
Kommentar zur aktuellen Außenpolitik der Vereinigten Staaten verstehen
lasse. Auch dies ein Gedanke, über den man ersteinmal nachdenken muss-
vielleicht in der „realen„ Wärme eines Sonnentages. |
|

 |
 kunst in münchen |
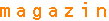 berichte, kommentare, archiv |
 kulturinformation im internet |